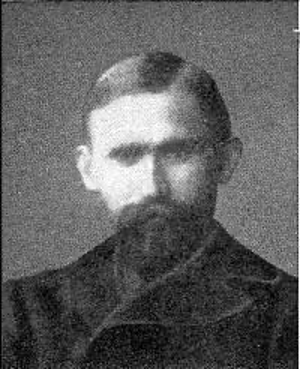Wie der Mönch Suriyagoda in weltlichem Stande geheißen habe, ehe er in den Orden des Erhabenen getreten war, dessen wußte sich niemand mehr zu entsinnen. So lange lebte er schon im Orden. Auch über sein Alter wußte niemand etwas sicheres. Kopf und Gesicht trug er stets glatt geschoren, auch seine Haltung war stets aufrecht. Trotzdem behaupteten manche, daß er das achtzigste Lebensjahr längst überschritten habe, und daß es die Strenge und Leidenschaftslosigkeit seines Lebenswandels sei, die ihn über das Alter siegen lasse.
Er war von einer wahrhaft vollendeten Magerkeit, und sein Auge leuchtete in einem so gleichmäßig milden und doch so starken Glanze, daß alle, die ihm nahe kamen, eher einen verklärten Geist als einen unreinen Körper zu sehen meinten.
Auch stand er längst im Geruche, die Arahatschaft erreicht zu haben, zur Einsicht gekommen zu sein: „Dieses ist meine letzte Geburt; nie wieder werde ich auftauchen im Strudel des Samsara.“ Er selber freilich hatte nie auch nur eine Andeutung darüber gemacht. Denn daß einer sich seiner höheren Einsichten rühmt, anderen oder sich selber gegenüber, das gibt es nicht im Orden des Erhabenen.
Seine Klause lag abseits von den anderen, auf dem Wege zum At-Vihara, und wenn die Gläubigen an Mahasāya-Dagoba angebetet hatten und zum At-Vihara hinaufgingen, so pflegten sie auch vor seiner Schwelle Blüten vom Tempelbaum niederzulegen. So groß war der Ruf seiner Tugend und Weisheit.
Mit Suriyagodas Erwachen war es merkwürdig zugegangen. Freilich ist das innere Erwachen der Menschen stets das Merkwürdigste des ganzen Lebens, aber selbst die ältesten Theras wußten sich niemandes zu erinnern, bei dem das Erwachen so früh eingetreten war wie bei ihm. Auch die Umstände, unter denen sich alles ereignet hatte, waren einigermaßen merkwürdig. Der Eine erwacht wohl, wenn er einen kranken Menschen, ein zu Tode getroffenes Tier sieht; ein Anderer, wenn er sinnend sitzt und den Wind in den Blättern säuseln hört; wieder ein Anderer, wenn er eine Flamme züngeln, ein Licht verlöschen sieht; die meisten freilich, wenn sie, nach dem Almosengange zurückgekehrt, sich an einem stillen Orte niederlassen, die Beine gekreuzt, den Körper gerade aufgerichtet und der Einsicht pflegen, wie sie vom Buddha belehrt worden sind. So trifft es den Einen so, den Andern so, je nach den Vorbedingungen. Mit dem ehrwürdigen Suriyagoda war alles folgendermaßen zugegangen:
Er war wiedergeboren worden in das Haus eines reichen Brahmanen, der von Süd-Indien arm herübergewandert war nach Lanka und in Anuradhapura in Diensten des Königs stand, weil er einiges konnte, was die eigenen Untertanen des Königs nicht konnten.
Dieser Mann wohnte in der Nähe des Tempels, den man schlechthin den Pfau-Tempel nannte, nicht weit vom heiligen Bo-Baume, dem täglich ungezählte Scharen von Anbetern ihre Ehrfurcht erweisen. Er selber freilich hielt fest am Glauben seines Heimatlandes, in dem man Shiva anbetete. Er verachtete das Gesetz des Buddha und nannte es eine vergrübelte Narrenlehre, weil er es eben nicht verstand. Die Mönche aber im Orden des Erhabenen nannte er „kahlgeschorene Pfaffen“. Deswegen geschah es nie, daß diese auf ihrem täglichen Almosengange vor seiner Tür stillstanden, um Gabe in Empfang zu nehmen.
Eines Tages nun kam ein fremder Bhikkhu durch Anuradhapura, um in Mihintale am Mahasaya-Dagoba Ehrfurcht zu erweisen.
Das war so gekommen:
Seit vielen Jahren lebte er fern im Süden in Tissamaharama, ernsthaft, enthaltsam, innig bemüht um Einsicht. Denn das sieht ja jeder Nachdenkliche bald, daß Leben zwecklos ist, und hat es Zwecke, daß sie von uns hineingelegt sind; also wozu das Ganze, wozu? Antwort gibt nur der Tathāgata.
Zu diesem Mönch kam eines Tages ein Mönch aus dem Norden der Insel. Der erzählte von der Heiligkeit der Plätze dort oben, so daß den Anderen ein Verlangen ankam, dort Ehrfurcht zu erweisen. Als nun sein Besucher ihn aufforderte, mit ihm nach Norden zu gehen, da stand er, wie er gerade dasaß, auf und sagte: „Gut, so laß uns gehen!“ Der Andere aber hatte allerhand Habseligkeiten bei sich, die er im Pánsala niedergelegt hatte, so daß er nicht sogleich aufbrechen konnte. Da sagte der Tissamaharama-Mönch: „Du bist kein rechter Jünger des Erhabenen. Es dürfte besser sein, allein zu gehen.“ Damit wandte er sich und trat unverzüglich seine weite Reise an; denn von Tissamaharama bis Mihintale sind wohl zwölf Tagemärsche oder mehr.
Dieser Mönch nun trat, als er auf seiner Wanderung durch Anuradhapura kam, vor des reichen Brahmanen Haus und wartete schweigend auf Almosen; denn er wußte nicht, daß dieser die Bhikkhus verspottete und kahlgeschorene Pfaffen schimpfte.
Der Brahmane saß gerade in der offenen Vorhalle seines Hauses beim Essen und hatte viele und reiche Gerichte vor sich, wie es so seine Gewohnheit war.
Als nun der Mönch herantrat und schweigend am Tore stehen blieb, da, wo an jeder Seite ein kleiner Elefant aus Stein den Eingang bezeichnete, da wandte er sich ein wenig seitwärts, gleichsam als ob er ihn nicht sähe; denn er war nicht nur ein Verächter des Dharma, sondern auch ein Geizhals. Suriyagoda aber war damals etwa zwölf Jahre alt.
Als nun der Knabe sah, daß sein Vater dem Mönch nicht geben wollte, trat er auf diesen zu und sagte, gleichsam um seinen Vater zu entschuldigen: „Er genießt die Frucht früherer Taten.“ Er meinte: Mein Vater lebt jetzt üppig, weil er in früheren Leben Gutes getan hat, wofür ihn jetzt der Lohn trifft. Worauf der Mönch, ohne den gesenkten Blick vom Boden zu erheben, erwiderte: „Und ich lehre die Frucht früherer Taten.“
Bei diesen Worten wurden die Augen des Knaben weit. Wie unschlüssig stand er da, dann sagte er leise:
„Wenn du die Frucht früherer Taten lehrst, so will ich mit dir gehen.“
„So mußt du zuvor deinen Vater um Erlaubnis bitten.“
Da trat der Knabe auf den Essenden zu und sagte: „Vater laß mich mit diesem da gehen.“ Und mit einer Stimme, die gedämpft war vor verhaltener Leidenschaft, fügte er hinzu:
„Er lehrt die Frucht früherer Taten.“
Der Alte hielt erstaunt im Essen inne.
„Siehst du nicht, daß es so einer ist? Weißt du nicht, daß du eines Brahmanen Sohn bist?“
„Vater, er lehrt die Frucht früherer Taten. Laß mich mit ihm gehen.“
Und zum zweiten Male der Alte:
„Siehst du nicht, daß es so einer ist? Wer soll an meinem Grabe die Totenopfer vollziehen, wenn du uns verläßt? Überdies haben nicht auch die Rishis die Frucht der Taten gelehrt?“
Der Knabe stand bedrückt; denn er fühlte, daß sein Vater recht hatte mit dem Totenopfer. Indem kam des Brahmanen jüngeres Söhnchen, das er mit einer anderen Ehefrau gezeugt hatte, in die Halle gehüpft und schrie wie zum Scherz einmal über das andere: „Vater, Vater!“
Da richtete sich der Knabe plötzlich auf und sagte zum dritten Male:
„Laß mich mit dem Manne gehen. Ich will nicht Speise, nicht Trank nehmen, läßt du mich nicht gehen.“
Weil nun der Vater merkte, wie es mit dem Kinde stand, daß es das Geheimnis des Samsara gewittert hatte, sagte er, schweren Herzens und dem Mönche grollend: „So geh!“ Dann aber, als er den am Tor noch unbeweglich und gesenkten Blickes dastehen sah, überkam es ihn, und sich vor seinem eigenen Groll fürchtend, daß er ihm in diesem oder einem folgenden Leben schaden könnte, rief er dem Mönche zu: „Mönch, ich zürn’ dir nicht!“
Es war aber auch schon vorher eigen zugegangen mit ihm.
Noch als kleiner Knabe hatte er einst zwei Papagei-Mangos vom Gärtner geschenkt bekommen. Da dachte er:
„Ich will den einen auf den Altar legen für Sivī und will den anderen nicht eher essen, als bis sie den ihren genommen hat.“
So legte er die Frucht hin und wartete, mit der anderen Frucht in der Hand.
Aber die Göttin nahm die Gabe nicht. Sehnsüchtig blickte der Knabe bald auf den Mango in der Hand, bald auf den auf dem Altar. Ihn hungerte, auch aß er Mangos für sein Leben gern. Er begann leise zu weinen, erst in sich hinein, dann lauter und lauter, bis schließlich sein Vater kam.
Als der ihn sah mit dem Mango in der einen Hand und dem anderen Mango auf dem Altar, fragt er:
„Was ist das, Sohn?“
„Für Sivī, Vater! Sie nimmt nicht.“
„Sohn, es ist auch nicht so, daß die Götter nehmen.“
Damit nahm er den Mango vom Altar und gab ihn dem Knaben. „Iß nur!“ Worauf dieser schnell beide Früchte verzehrte.
Eine geraume Zeit danach fragte er seinen Vater unvermittelt:
„Vater, wie ist es, daß die Götter nehmen?“
Der Alte wußte erst nicht, was die Frage sollte. Dann erinnerte er sich der Mangos.
„Sohn, es ist nicht so! Die Götter sind geheimnisvoll. Sie nehmen, sie geben — wir wissen nicht wie.“
Der Knabe schwieg dann.
„Und die in Tanjor?“
Er meinte die Priester am Subrahmanya-Tempel in Tanjore, ob die etwa mehr wüßten.
Solch ein Knabe war Suriyagoda gewesen von jeher.
So nahm er jetzt seine Matte und sein Trinkgefäß und folgte dem Gelben nach.
Der schritt fürbaß, ohne den Kopf zu heben, die Tempelstraße entlang, am Abhayágivi-Dagoba vorbei dem Tissawēwa zu.
Als sie nun auf dem hohen Damme entlang gingen, über den der Sturm hinwegsauste, — es war gerade die Zeit des Monsun — da sah der Knabe mit Staunen, wie der See weiß am Ufer schäumte. Gespenstern glichen die grauen Stümpfe abgestorbener Bäume, die halb im Wasser ertrunken dastanden und ihre toten Äste in die Luft streckten. Jetzt wandte er den Kopf und sah hinter sich, weit, am anderen Ufer Ruanweli hochragen wie ein Gebirge, in seinem marmorweißen Mantel glänzend wie Silber.
„Wie weit bin ich fort von Hause“ dachte er. Er war noch nie hier gewesen; denn die Kinder vornehmer Brahmanen verlassen selten das Haus, weil sie Unreinheit fürchten.
Ihm wurde schwer und ängstlich zu Mut. Er dachte: „Ich will warten, bis jener da wieder vor einer Hütte stehen bleibt und um Almosen bittet; — denn im Hause seines Vaters hatte er nichts bekommen — dann will ich um Erlaubnis bitten, zurückkehren zu dürfen, ich fürchte mich.“ Dabei sah er auf den Mönch, der vor ihm schritt, schweigend, das Haupt gesenkt, das gelbe Gewand gebläht im Winde wie eine Glocke.
Der aber dachte bei sich: „Die Sonne hat ihren höchsten Punkt bereits überschritten; die schickliche Zeit zum Essen für heute ist vorbei. So ist es besser, ich warte bis morgen.“
So gingen sie an den letzten Hütten vorüber, ohne daß jener still hielt, und der Knabe trottete hilflos hinter ihm drein, immer in der Hoffnung, daß jener stille stehen oder sich wenden würde.
Und wie schrecklich war erst der Wald, in den sie jetzt traten. Vom Sturm draußen gab es hier nichts. Regungslos alles, wie gelähmt von etwas furchtbarem, bei dem das Herz fragt: „Was mag es nur sein?“ und aus dem Ausbleiben jeder Antwort neue Schrecken saugt.
Die Augen schmerzten ihn, wenn er auf die Straße sah, die weiß, blendend, scheinbar endlos sich vor ihm dehnte und über der die Luft flimmerte. Seitwärts am Wege aber standen diese mächtigen Termitenhaufen, und mit ängstlicher Scheu sah er große, häßliche Eidechsen auf ihnen, die den Kopf erhoben, das Maul geöffnet, regungslos dasaßen, wie bezaubert von dieser grimmigen Sonne. „Gewiß, es sind böse Geister“ dachte der Knabe und blickte starr vor sich.
So mochten sie wohl zwei Stunden gewandert sein, da kamen sie an die ersten Häuser eines anderen Ortes. Hinter dem erhob ein zweigipfeliger Fels sich hoch in die Luft. Beide Gipfel aber waren gekrönt mit einem Dagoba.
Der Knabe wußte wohl, das war Mihintale, das heilige Mihintale, aber nie vorher war er hier gewesen.
An einem lieblichen Weiher, voll von Lotus, vorbei schritt der Mönch auf diesen Berg zu. Die geisterhaften Schrecken des Waldes waren vorüber. Machtvoll wehte der Wind über die Wasserfläche. Von weitem schon winkte eine mächtige Eingangspforte. Durch sie schritt der Mönch; Suriyagoda eng hinterdrein. Sie waren plötzlich wie in einer anderen Welt. Große und kleine Dagobas, Hallen für Gebet und Speisung, heilige Feigenbäume, von Mauern umrahmt, Steintafeln mit Inschriften, Bäder in schön behauenen Stein gefaßt. Zwischen dem allen eine Treppe, deren Stufen große Steinquadern bildeten, flach und so breit, daß wohl vier Elefanten nebeneinander auf ihr gehen konnten. Diese Flucht von Stufen verlor sich nach oben zu im geheimnisvollen Halbdunkel des Urwaldes: die heilige Treppe von Mihintale.
So verlebte Suriyagoda in Mihintale, dem heiligsten Platze, Jahr für Jahr. Früh vor Sonnenaufgang erhob er sich zusammen mit den anderen Klosterschülern. Dann wurde der Hof gefegt, Blüten von den Bäumen geschüttelt, um sie vor dem Buddha-Bilde nieder zu legen. Die Mönche sangen im Vihara, auf der Erde vor dem Buddha-Bilde knieend, Gesänge, die in ihrer Monotonie dem Klange tiefer Glocken glichen; Gesänge zum Preise des Buddha, zum Preise des Gesetzes, zum Preise der Mönchsgemeinde. Hörte der Gesang dann plötzlich auf, so tönte es von den geschlossenen Lippen der Mönche noch ein Weilchen weiter, wie das Nachschwingen in Erz.
Schon früh wurden die Knaben angehalten zum Meditieren über Menschenliebe, über Wohlwollen gegen alles Lebende, über die Allvergänglichkeit, über die Unreinlichkeit alles Körperlichen und über den Tod. Auch mußten sie sich fleißig üben die Gedanken zu regeln durch achtsames Ein- und Ausatmen. Auch die heiligen Schriften wurden gelesen, indem ein älterer Mönch vorsprach und die Schüler nachsprachen, vorläufig freilich ohne Sinn und Bedeutung zu verstehen. Am Abend sangen die Mönche wieder vor dem Buddha-Bild im Vihara.
Wie lieblich aber waren die Festtage an den Neu- und Vollmonden, wenn alle Anhänger kamen, schon früh am Tage, lautlos, in blütenweißen Kleidern, alle Männer, Weiber und Kinder, ganze Körbe voll gelber und weißer Blüten brachten und vor dem Buddha-Bilde aufhäuften, so viel als ob es die ganze Nacht Blumen geregnet hätte; wenn dann alles still niederkniete und ein Mönch die Satzung rezitierte.
Wenn aber abends der ganze Vihara vom Glanz der Lichter strahlte, dann kam es dem Knaben wohl vor, als ob die bewegungslose Ruhe des Buddha-Bildes Leben bekäme. Das Gesicht schien im Ausdruck zu wechseln, die Lippen sich zu regen, die zum Predigen erhobene Hand sich zu bewegen. Eine inbrünstige Ehrfurcht wallte dann im Herzen des Knaben. Er mußte sich Gewalt antun, hier nicht anzubeten, wie er es im Hause seines Vaters gewohnt war. Denn das muß man ja wissen, daß man zu einem Buddha nicht beten kann; daß man ihm nur Dank und Ehrfurcht erweisen kann dafür, daß er den Weg, den er selber gefunden, auch uns, der Welt, gezeigt hat. Es war die mit der Muttermilch eingesogene Gottsucht, die noch in dem Knaben arbeitete und seine Einsicht hinderte.
Am Abend spät begann dann das Predigen, das oft bis tief in die Nacht dauerte. Gepredigt aber wurde von der Vergänglichkeit, dem Leiden, der Wesenlosigkeit aller Dinge; dem Unbefriedigenden, Leiden züchtenden der Lust, dem Segen des Entsagens. Wovon sonst sollte auch wohl ein Mensch dem andern predigen!
Am Tage nachher aber folgte dann das Beichten der Mönche. Mit gefalteten Händen knieten sie vor dem Abte nieder und sprachen mit diesen tiefen, klangvollen Stimmen:
„Herr, wenn wir unwissentlich mit einer der drei Pforten (Tat, Wort, Gedanke) gefehlt haben, so vergib uns.“ Worauf der Abt erwiderte:
„Ich habe vergeben. So vergebt auch ihr mir.“
So wird im Orden des Erhabenen gelebt, den der Erhabene selber „das unvergleichliche Feld um Verdienst zu erwerben“ nennt. Und wirklich sind ja diese Mönche, indem sie ständig allem Lebenden in einem Wohlwollen zugetan sind, die größten Wohltäter der Menschheit. Ein einziges Herz voll heiterer Entsagung trägt ja zum Wohle der Menschheit mehr bei als ein ganzes Leben voll rastloser Philantropie.
Es war nun die Zeit gekommen, daß Suriyagoda mit der Robe bekleidet, d. h. selber Mönch wurde. Wie die anderen machte er von da ab alle Vormittage seinen Almosengang, indem er, das Gewand schicklich geordnet, gefaßten Sinnes, gesenkten Auges von Haus zu Haus ging und an den Türen schweigend wartete, bis ihm der Reis in die Almosenschale getan wurde. Kam dann der Geber, hatte den Reis in die hingehaltene Schüssel hineingetan und auf der Erde kniend, die gefalteten Hände vor dem Gesicht, seine Ehrfurcht erwiesen, so ging der Mönch schweigend weiter zur nächsten Tür, bis die Schale zur Genüge gefüllt war. Dann trat er den Rückweg zum Kloster an und verzehrte dort, stets unter dem gleichen Schweigen, sein Mahl an einem einsamen Orte.
Eines Tages nun, als Suriyagoda schweigend dastand, gesenkten Blickes und auf die Gabe wartete, trat plötzlich ein Mensch auf ihn zu, der war nackt bis auf einen Eulenflügel, der seine Scham notdürftig deckte. Die Haut war Asche beschmiert und sah aus wie graues Leder; die Haare verfilzt wie eine schmutzige Kokusmatte; der Blick wirr und unheimlich.
Der sprach leise aber heftig zum Mönch:
„Du, es ist mir gegeben, in deiner Zukunft zu lesen. Ehre und Lob dem Allmächtigen! Du mußt durch eine große Liebe gehen.“
Dann dicht vor Suriyagoda hintretend fuhr er lauter fort:
„Wolltest du deine Augen nur einmal heben, so könnte ich dir sagen, wo und wie.“
Suriyagoda verharrte unbeweglich. Es überkam ihn etwas Unheimliches, einer jener Schauer aus unbekannten Regionen, unter denen er als Knabe so oft gelitten hatte; jene Schauer, die den in Weisheit noch nicht gefestigten immer wieder fragen lassen: „Gibt es doch wohl etwas hinter dieser Welt hier, das über uns herrscht?“
Er fühlte instinktiv, wenn er den Blick heben und das Auge dieses Menschen treffen würde, so würde es ihn greifen, ihn ansaugen, er würde fallen — einer grundlosen Tiefe zu.
Indem erschien der Anhänger, um den Reis in die Schale zu schütten. Als er den Fakir sah, winkte er mit der Hand und rief „husch, husch!“, wie man Krähen von einer Schüssel scheucht. Worauf der sich eilig abwandte, aber knurrend und schnüffelnd, wie ein Jagdhund, der eine Spur gewittert hat und sie nicht verfolgen darf.
Am selben Abend, als Suriyagoda, bevor er zur Ruhe ging, vor dem Abt niederkniete und ihm Ehrfurcht bezeugte, bat er ihn um die Erlaubnis, in Zukunft, wenn er den Anhängern und Anhängerinnen predigte, hinter einem Palmblatt-Fächer sitzen zu dürfen. Er wollte sich dadurch davor schützen, daß sein Auge auf irgend etwas träfe, was ihm Liebe erregen könnte, denn er dachte: „Wofür bin ich schon als Knabe in den Orden des Erhabenen getreten, wenn ich doch die Qualen und den Schmutz der Liebe durchmachen muß? Es ist besser, ich schütze mich beizeiten.“
Nun war Suriyagoda von schöner Gestalt, schlank aber kräftig, von feinem Gesicht, mit vollem, freiem Auge und von hoher Anmut bei allem was er tat und redete. Daher war die Predigthalle stets am vollsten, wenn er den Anhängern und Laien predigte.
So fragte der Abt, weshalb er denn von jetzt ab hinter dem Fächer predigen wolle? worauf Suriyagoda stockte und errötete, dann aber die Sache mit dem Fakir berichtete.
Der Abt lächelte ein wenig und gab ihm die Erlaubnis. Dann aber, als leisen Tadel, fügte er den Spruch des Erhabenen hinzu: „Ist dieses, wird jenes; ist dieses nicht, wird jenes nicht,“ womit er sagen wollte, daß ein jeder Mensch aus dem jetzigen Moment heraus sich das nächste selber schaffe, je nachdem was er tut, was er redet, was er denkt. Und wie bei einem rollenden Stein ein Moment der Bahn das nächste bestimmt, und dieses wieder das nächste, so auch beim Menschenleben. Nicht in den Händen eines Schwärmers oder der Gestirne liege unsere Zukunft, sondern in den Händen dieses Jetzt hier, das ich selber bin.
So predigte von jetzt ab Suriyagoda Jahr für Jahr hinter einem Palmblattfächer. Die Prophezeiung des Fakirs hatte er längst vergessen, aber der Fächer war ihm so zur Gewohnheit geworden, daß er überall der Fächerprediger hieß.
Einstmals, am Upósatha-Tage des Vessak-Monats veranstaltete der König eine große Feier zu Ehren des Erhabenen. Die ganze Straße von Anuradhapura bis Mihintale, zwei Wegstunden lang, war mit gelben und weißen Blüten bestreut. Überall am Wege hingen Fahnen und Banner.
Zur festgesetzten Stunde verließ der König seinen Palast in der Nähe des Jetavanarama-Dagoba mit dreiunddreißig Elefanten. Auf ihnen ritten die Adeligen, immer je vier in einer Reihe; an der Spitze aber der König auf dem Königselefanten, der von Gold und Edelsteinen glänzte.
Dieser Elefant war so einer, von dem man sagt: „Er hat seinen Rüssel preisgegeben.“ Denn ehe ein Elefant nicht im Kampf den Rüssel preisgibt, leistet er nicht das höchste. Hat er aber den Rüssel preisgegeben, so kann ihm nichts mehr widerstehen.
Hinter den Elefanten folgte die Mönchschaft vom heiligen Bo-Baum und der anderen Klöster Anuradhapuras in Sänften; dahinter aber das Volk zu Fuß.
Wie ein einziger Sadhu-Ruf ging es von der Hauptstadt bis hin nach Mihintale.
Als nun der Zug am Ambastalla-Dagoba angekommen war, da stiegen alle, selbst der König, ab; denn hier ist der heiligste Platz Ceylons nahe: die Höhle, in welcher Mahinda, König Açokas Sohn, der Apostel Ceylons, sein Leben in Heiligkeit, d. h. heil von Leidenschaften und Lüsten, verbrachte. Das Felsenbett auf dem Boden dieser Höhle ist heute noch zu sehen.
Hier nun stießen auch die Mönche von Mihintale, Suriyagoda mit ihnen, zum Zuge.
Vom Ambastalla-Dagoba stieg alles, der König an der Spitze, zum Mahasaya-Dagoba hinauf, auf jenen schwarzen Fels, in welchen flache Stufen hineingehauen waren. Wer aber unten die schneeweißen Gewänder auf dunklem Grunde leuchten und die goldenen Banner und Standarten in der Sonne funkeln sah, der meinte, es wäre das schönste Schauspiel, das Menschen überhaupt schaffen sowohl wie betrachten könnten.
Nun hatte es vor kurzem einen starken Regenfall gegeben und in den Löchern der Steinstufen standen noch Wasserreste. Als nun der König, Upatissa war sein Name, in feierlicher Langsamkeit hochschritt, da sah er in einer dieser Lachen ein Insekt dem Ertrinken nahe. Sofort regte sich Mitleid mit dem Lebendigen in ihm; er machte Halt und, indem er den flimmernden Pfauenwedel in die Pfütze hineintauchte, rettete er das Tierchen vom Ertrinken.
Als das umstehende Volk das sah, da wurden die Sadhu-Rufe noch viel freudiger. Denn wie der König es liebt, ein frommes gesetzes-freudiges Volk zu haben, so liebt auch das Volk, einen frommen König zu haben.
Mit dem Stillstehen des Königs ging eine Stockung durch den ganzen Zug und ein jeder fragte, was geschehen sei, wobei dann, sobald Antwort kam, das Sadhu-Rufen immer wieder aufs neue hochflackerte, wie ein Feuer, das über trocknen Grasgrund hüpft.
Auch Suriyagoda ließ seinen Palmblattfächer, der groß war wie ein Schild und ohne den er nie seine Zelle verließ, sinken und sah sich um. Dabei fühlte er ein paar Augen auf sich gerichtet und verbarg sich sofort wieder hinter seiner Wehr. Aber einige aus dem Volke hatten ihn gesehen und raunten sich zu: „Der Fächerprediger! Es ist der Fächerprediger!“ Er stand nämlich bei diesen Leuten in hoher Achtung. Denn wer einen reinen Lebenswandel führt und sich bezähmt, der verdient und erhält Achtung.
Nachdem nun der König und der ganze Zug den Mahasaya-Dagoba, ihn zur rechten Hand habend, feierlich umwandelt und auf allen Altären Blüten niedergelegt hatte, kehrten der Hof nach Anuradhapura und die Mihintale-Mönche in ihre Klausen zurück.
Am nächsten Morgen fand Suriyagoda die Schwelle seiner Hütte mit Blumen bestreut.
Gewöhnt an derartige Ehrfurchtsbezeugungen achtete er nicht darauf. Dieses wiederholte sich Morgen für Morgen und Suriyagoda tat nichts als täglich die Blumen wegzufegen.
Eines Abends gegen Dunkelwerden hörte er ein Geräusch vor seiner Tür. Als er öffnete, sah er ein junges Weib auf den Knien liegen, die Hände anbetend vor dem Gesicht.
Suriyagoda verharrte regungslos die schickliche Zeit. Denn der Mönch muß schicklicher Weise warten, bis der Laie seine Ehrfurchtsbezeugung vollendet hat.
Als das Weib aber liegen blieb, sagte er:
„Was ist?“
Die blieb erst regungslos, dann sagte sie leise:
„Das Glück, sagt man, Bhante, das Glück.“
Einen Moment war es, als ob sie sich aufrichten wollte, aber sofort sank sie wieder zusammen.
Suriyagoda schwieg betroffen. Dann sagte er ruhig:
„Geh!“
Und wieder das demütige, lockende:
„Das Glück sagt man ja, Bhante, das Glück.“
Dabei wiegte sie leise den tiefgesenkten Kopf, sodaß die Wellen bis zu den vollen Hüften zu gehen schienen.
Suriyagoda blickte starr gerade aus.
„Freilich, Weib! Das Glück, sagt man ja, das Glück. Aber was ihr da draußen Glück nennt, das ist Unrat und Verderben im Orden des Erhabenen. Und was ihr da Verderben nennt, das ist Glück und Schmuck im Orden des Erhabenen. Aber geh! Ich darf hier nicht zu dir reden.“
Der Körper des jungen Weibes zuckte von unterdrücktem Schluchzen. Mitleidig neigte sich Suriyagoda. Berühren durfte er sie nicht, aber er wollte ihr im Näherkommen seiner Stimme Trost geben.
Sei es nun, daß das Weib sehr erregt oder schnell gestiegen war: Indem Suriyagoda sich herabbeugte, stieg der Duft der Haut zu ihm empor. Verwöhnt, überempfindlich gemacht durch die strengen, aber keuschen Klostergerüche richtete er sich schnell auf. Dieser Duft war ihm zuwider. „Geh, geh!“ sagte er fast ungeduldig.
Bei dieser dritten Aufforderung erhob das Weib sich; die gefalteten Hände vor dem Gesicht behaltend wandte sie sich schnell und verschwand in der Dämmerung.
Gerade in diesen Tagen wurde das Kloster, in welchem Suriyagoda lebte, von einem schweren Schlag betroffen, indem der Abt, Suriyagodas Lehrer, plötzlich starb.
Suriyagoda war sein Lieblingsschüler gewesen. Jahrelang hatten sie sogar dieselbe Zelle geteilt — der Ältere, um stets Belehrung geben, der Jüngere, um stets Belehrung empfangen zu können.
Dem scharfen Auge des alten Denkers war Suriyagodas Charakter bis in seine Tiefen klar. Denn sobald man das Licht der eigenen Ichsucht ausgelöscht hat, sieht man jeden Schein im Innern des Anderen:
Dem Abte war nicht entgangen, daß Suriyagoda, trotz seiner Aufnahmefähigkeit für die Lehre des Buddha doch immer noch durch das körperliche Material, das er auf Grund seines Karma verarbeiten mußte, am fessellosen Erkennen gehindert wurde; daß er immer noch an der Fessel des Gottesglaubens krankte, wenn auch in jener reinen, höchsten pantheistischen Form des Vedanta, die aber, wo es auf völliges Durchdringen des Dharma ankommt, eben so hinderlich ist, wie der rohe Glaube an einen persönlichen Gott.
Eines Tages, nach längerer Unterredung sagte er zu Suriyagoda:
„Die Liebe, vor der du dich durch den Palmblattfächer schützen willst, ist gar nicht eine solche Liebe, daß man sich vor ihr durch äußere Mittel schützen könnte.“
Suriyagoda verstand nicht. Da jener aber nichts weiter sagte, so wagte er nicht zu fragen.
Der war nun plötzlich gestorben, aufrichtig betrauert von seinen Mönchen und seiner ganzen Gemeinde. Und das Kloster war vorläufig ohne Abt. Mancher munkelte, daß Suriyagoda trotz seiner Jugend (er war damals noch nicht 30 Jahr alt) sein Nachfolger werden sollte. Suriyagoda selber würde eine solche Ehrung ausgeschlagen haben. Sein Streben ging nicht auf Amt und Würden, sondern auf ein Leben stiller Nachdenklichkeit. Wer erkannt hat, wozu er lebt, der weiß auch, daß jeder Augenblick aufgeht im Arbeiten an sich selber, im stillen zähen Kampfe mit sich selber.
In der ersten Zeit nach dem Tode des Abtes, wenn die Mönche abends still und beklommen in der weiten Halle saßen, in welcher das flackernde irrende Kokosnuß-Lämpchen nur Schatten, nicht Licht zu geben schien, da tauchte leise immer wieder die Frage auf: „Wohin mag er wohl wiedergeboren sein?“, eine Frage, auf die freilich niemand eine andere Antwort geben konnte als die: „Dahin, wohin seine Taten ihn geführt haben.“ Denn nicht Vater und Mutter, sondern die Taten dieses Lebens wahrlich sind der Mutterschoß, aus welchem das nächste Leben hervorgeht. Deswegen ist es ja, daß der Buddha die Wesen „Karma-entsprossen“ nennt, nicht „Eltern-entsprossen.“
Daß der Alte weiter wandern mußte im Samsara, daß er Nirwana, das Ende, das Verlöschen, noch nicht erreicht habe, darüber war ja freilich kein Zweifel. Er selber hatte es noch in seinen letzten Stunden gesagt, aber in Ruhe und Fassung, so daß man wohl die frohe Hoffnung heraus hörte, nicht in niederen Wesenheiten wiedergeboren zu werden. Man wußte auch, daß der Verstorbene nicht ganz frei war vom Hängen an gewissen kleinen Lüsten dieser Welt. Fast scherzhaft war seine Neigung für Süßigkeiten gewesen und seine Anhänger, die seine Vorliebe kannten, hatten ihn stets reichlich damit versorgt.
Als nun eines Abends wieder die große Frage erörtert wurde: „Wohin mag er wohl wiedergeboren sein?“, da meinte einer der Klosterschüler, der mittags die Schalen der Mönche am Brunnen wusch, ein kleiner Knirps, aber keck wie einer:
„Beim Zuckerbäcker!“
Suriyagoda verwies ihm solche unziemliche Rede ernsthaft und sandte ihn zur Strafe aus der Halle; aber ein Weilchen herrschte Schweigen, weil jeder mit einem Lächeln kämpfte.
Von diesem Abende an wurde die Frage der Wiedergeburt des Abtes nicht mehr berührt.
Suriyagoda befand sich damals in einer merkwürdigen Verfassung. Im Verlauf jener Unterhaltung, an deren Schluß der Abt ihm gesagt hatte, daß jene Liebe, durch die er gehen müsse, nicht durch einen Palmblattfächer abzuwehren sei, hatten sie über den Wert der Religionen gesprochen und der alte Abt hatte das Christentum mit ungewohnter Schärfe abgetan. „Es befriedigt weder das Bedürfnis des Menschen nach Wissen, noch sein Bedürfnis nach Gerechtigkeit. Laß dich,“ fuhr er eindringlich fort, „nicht durch dieses Aushängeschild der Liebe bestechen. Erste Pflicht der Menschen ist nicht die Liebe, sondern das Denken. Höchstes Menschtum liegt nicht im Lieben, sondern im Denken. Lieben tun die Tiere auch, denken tut nur der Mensch — und die Götter,“ fügte er mit einem Lächeln hinzu. „Liebe ohne denken ist, als ob der Karren den Ochsen zieht.“ Er meinte, Liebe solle stets vom Denken geleitet werden, nicht ihm vorauslaufen.
Dann hat Suriyagoda um die Erlaubnis gebeten, die Upanishaden in der Ursprache lesen zu dürfen. Er war der beste Sanskrit-Kenner des ganzen Klosters.
Der Alte hatte nicht gleich geantwortet. Die weichen Hände ein wenig fester zusammenpressend hatte er in den Klostergarten hinausgeblickt, wie interessiert in die letzten Regentropfen, die von den Palmblattwedeln an der Halle zur Erde fielen. Dann hatte er ruhig gesagt: „Wenn du willst, so lies.“ Nach diesem hatte er dann jene Worte von Suriyagodas Liebe gesprochen, die der Mönch nicht verstanden hatte.
Noch am selben Abend hatte Suriyagoda seine Lektüre begonnen. Er las und las. Ihm war, als ob er ertrinken müßte in diesem Gedanken-Ozean. Was waren das für Menschen, diese Gott-Trunkenen, Yajñavalkya, der in Worten und Gedanken spricht, welche Himmel und Erde gleichsam mühelos in sich hineinsaugen; diese Maitreyi, die da sagt: „Gieb mir nicht, was man Weibern gibt — jenes große Wissen gib mir, das du hast.“ Sie meinte das Wissen von der Einheit zwischen Mensch und Gott. War es nicht etwas ungeheuerliches, mit einem einzigen Erkenntnisakt jenes Wissen zu erreichen, das Seligkeit gibt für immer! Denn kann der Mensch größere Seligkeit fühlen, als die Erkenntnis: „Ich und Gott, wir sind eines Wesens; ich Gottes, Gott meines Wesens und Täuschung, wahrlich, ist das, was mich von der All-Einheit trennt.“ Wie anders, wie erhaben war das alles in Vergleich zu diesem dürren, nüchternen, mühevollen, ja unerhört hartem Ringen mit jeder Tat, jedem Wort, ja jedem Gedanken, wie die Lehre des Buddha es verlangt. Diese schreckliche, fast aussichtslose Arbeit des Gedankenbändigens, das Stillstellen der ewig mahlenden Räder, die sich selber mahlen, wirft man kein Korn zwischen sie. Wie eine Art Wollust überkam es ihn, wenn er an die Geheimnisse jenes mystischen Lautes dachte, den der Gott-Ergriffene von der zitternden Lippe schweigt. Kurz: Er sehnte sich aus der harten Arbeit des ewig wachen Denkens in die mollige Ruhe des Gottfriedens, wie der Knecht nach den Fleischtöpfen des Herrn.
Alle diese Stimmungen und Gefühle fanden ihr ständiges Gegengewicht im Dasein seines Lehrers. Mit dessen Tode ging das Steuer seines Lebensschiffes verloren. Immer tiefer arbeitete er sich in diesen Zwiespalt zwischen Verstand und Gemüt, zwischen Belehrung und natürlicher Neigung. Immer wieder freilich sagte ihm der Verstand: „Die Wahrheit lehrt der Tathāgata. Nur hier, wo gezeigt wird, daß ich selber Frucht meiner Taten bin, nur da ist Gesetz; nur wo Gesetz ist, ist Gerechtigkeit; nur wo Gerechtigkeit ist, ist Befriedigung.“ Aber das Erdige an ihm, das von Vater und Mutter stammte, hing sich wie ein Gewicht an den Flug dieses reinen Erkennens. Immer wieder raunte es in ihm: „Wenn es doch ein Ewiges gäbe! Wenn es doch eine Seligkeit gäbe, jenseits! Wenn dieses „Neti, Neti“ der Upanishaden doch dereinst unerhörte Wirklichkeit werden könnte! Wenn die alten Rishis doch Lehrer wären und nicht Schwärmer!“
Eines Tages ging er, müde vom fruchtlosen Denken, gegen Abend zum Ort hinunter. Er fühlte das Bedürfnis, andere Menschen um sich zu sehen, auch wollte er sich am Ufer des Sees, der einem großen Lotusteich glich, ergehen.
An einem abgelegenen Winkel, von den überhängenden Zweigen eines wilden Mangobaumes halb verdeckt, sah er einen Mönch aus dem Nachbarkloster sitzen. Der saß, die Beine gekreuzt, die Hände ineinander gefaltet, hoch aufgerichtet, da, und wiederholte immer das eine Wort: „Wasserkranich, Wasserkranich!“
Erstaunt hörte Suriyagoda ihm eine Weile zu; dann, weil der Andere ihn gar nicht bemerkte, räusperte er sich, trat höflich näher und ließ sich zu seiner Rechten nieder. Dann begann er:
„Bruder, ist wohl eine Frage erlaubt?“
„Freilich, Bruder.“
„Weshalb sagtest du eben in einem fort das Wort ‚Wasserkranich, Wasserkranich‘?“
Der sah ihn verdutzt an, dann erwiderte er:
„Bruder, nicht ‚Wasserkranich, Wasserkranich,‘ sondern ‚Vergänglichkeit, Vergänglichkeit‘ habe ich gesagt.“
„Verzeih, Bruder. Du sagtest ‚Wasserkranich, Wasserkranich‘.“
Da schlug sich der andere vor die Stirn und rief:
„Schöne Geschichte! Der Abt hat mir als Aufgabe zum Meditieren ‚Vergänglichkeit, Vergänglichkeit‘ gegeben, nun sitze ich hier und sehe die Kraniche auf dem Wasser hin- und herziehen, und statt, ‚Vergänglichkeit, Vergänglichkeit‘ sage ich ‚Wasserkranich, Wasserkranich‘.“ (Beide Worte unterscheiden sich nämlich nur durch einen Laut, so daß sie leicht zu verwechseln sind.)
Dabei lachte er lustig und auch Suriyagoda lachte so kräftig, wie er seit Jahren nicht gelacht hatte. Denn stille Heiterkeit gehört sich wohl im Orden des Erhabenen, aber hörbares Lachen ist nicht schicklich.
Als er zurückkehrte, dachte er bei sich: „So ist das nun, und das wird daraus.“ Er meinte: So ist die Lehre beschaffen, daß sie in dieser geistlosen Weise verarbeitet werden kann. Er fühlte auch nicht einmal, daß er ungerecht urteilte; denn zu geistloser Verarbeitung bietet auch die Lehre der Upanishaden Anhalt zur Genüge.
Der Zufall wollte es, daß er auf dem gleichen Spaziergange in der Nähe der großen Eingangspforte, auf dem Wege, der zum Rajagiri-Lena führt, zwei Männer traf, die auf einer Stange einen Sack trugen. Als sie an Suriyagoda vorbeigingen, sagte der eine: „Bhante, verzeiht, daß wir heute nicht Ehrfurcht erweisen können. Es ist dieses wegen da.“ Dabei zeigte er auf den Sack.
„Was habt ihr denn in dem Sack?“ fragte Suriyagoda.
„Herr“, antwortete derselbe Mensch, der vorhin gesprochen hatte, „es ist eine Cobra, dick wie mein Arm. Wir sollen sie töten.“
„Seit wann tötet ihr denn Lebendiges?“ fragte Suriyagoda erstaunt.
Der Mensch schwieg.
„Herr,“ begann der andere, „wir sind arm; es ist des Lohnes wegen.“
Damit schien sich dem ersten die Zunge wieder zu lösen und er begann eilfertig:
„Herr, die Sache ist die: Der Alte, unten am See, der die Lotusblüten auf dem Brett feil hält, hat uns gedungen, sie zu töten. Er sagt, es ist eine schlechte Schlange. Vor vier Jahren ist sie zu ihm an den Feuerplatz gekommen, da hat er ihr gesagt: ‚Was willst du hier? Das ist nicht dein Haus. Du weißt, dein Haus ist das Djangel‘. Darauf wendet sich die Schlange schnurstracks und huscht zum Walde zurück. Sie war damals noch eine gute Schlange. Gestern Abend nun tritt der Alte auf seine Plattform. Was liegt da? — die Cobra! — aufgerollt und zischt. Sie ist dick wie mein Arm, Herr. Er nimmt ein Steinchen und wirft es ihr zu. Ist so erschrocken, daß er ihr nicht zureden kann. Sie geht weg. Heute ist sie wieder da, zischt wieder. So meint der Alte, wenn er mal im Dunkeln auf sie tritt, wird sie ihn töten. Deswegen bat er uns, sie zu fangen und im Sack auf die Straße zu legen, daß ein Elefant sie zertritt.“
„Weiß denn der Alte unten, daß es die nämliche ist, wie vor vier Jahren?“
„Sicherlich Herr!“
„War sie denn damals schon ebenso dick?“
„Nicht doch Herr; sie war damals klein.“
„Wie kennt er sie denn wieder?“
„Er weiß es eben, Herr.“
Und wie zur Bekräftigung fügte der andere hinzu:
„Es ist so, Herr.“
Suriyagoda ging weiter und die beiden gingen die Straße entlang. Er hatte nicht das Recht, diesen Menschen zu sagen: „Ihr dürft nicht töten! Laßt das Tier frei! Seid ihr ihm wirklich wohlgesinnt, so wird es nicht beißen.“ Aber wieder deutete er parteiisch. Er dachte bei sich: „Ein Brahmane würde das nicht tun. Er würde eher sterben.“
In der nächsten Nacht hatte Suriyagoda einen Traum. Er sah den verstorbenen Abt, seinen Lehrer, greifbar deutlich vor sich stehen. Der sagte zu ihm:
„Suriyagoda, gehst du früh zum Eßsaal, ohne vorher im Vihara gewesen zu sein?“
Der Mönch erwachte mit einem Schreck, den Traum noch lebendig vor sich. Fast verdrossen fragte er sich:
„Was soll das? Ich bin doch nie zum Eßsaal gegangen, ohne vorher im Vihara gewesen zu sein.“ Aber da sein Gewissen der Lehre wie dem Lehrer gegenüber nicht rein war, so begann er seine Betübungen zu verlängern. Er entzog sich Schlaf, woran er nicht gewohnt war, — denn die Jünger des Buddha sind wohl an ein strenges, aber nicht an ein asketisches Leben gewöhnt — und wurde matt und überreizt dabei.
Die Mönche badeten damals im Naga-Pokana, dem Schlangenbad, so benannt, weil an der Felswand der einen Seite eine mächtige, dreiköpfige Cobra ausgemeißelt war.
Eines Tages geschah es, daß er sein Bad außer der Zeit d. h. gegen Abend nahm und infolgedessen allein badete.
Als er, wie es bei den Mönchen Sitte ist, mit dem losen Untergewand bekleidet, langsam ins Wasser stieg, sah er aus der Tiefe eine weibliche Person sich entgegenschweben, schön wie eine der Asparasen. Als er aber hinblickte, da sah er, daß es sein eigenes Spiegelbild war. Zum ersten Mal fiel ihm auf, wie mager und großäugig er geworden war. Halb belustigt, halb verächtlich lachte er auf:
„Soweit hätte ich es also gebracht, daß ich am hellen Tage von Weibern phantasiere.“
Still setzte er sich auf einen Fels und blickte auf dieses unvergleichliche Landschaftsbild zu seinen Füßen. Die Sonne ging zur Rüste, glorreich wie ein Held, in einen schier überwältigenden Strahlenmantel gehüllt. Über der unendlichen Waldfläche lag ein duftig violetter Schimmer und scharf hoben sich zur Linken die Dagobas von Anuradhapura — das Dreigestirn Ruanweli, Abhayagiri und Jetawanarama — aus dem grünen Meer — die ganze Welt ein einziger, stiller Feiertag.
Er saß da, der Körper gespannt, das Auge rücksichtslos am glühenden Sonnenball hängend. „Was ist dieses Leben ohne ein Göttliches“ sagte er endlich leise, als ob er sich vor dem Schall der eigenen Stimme fürchte. „Eine Nacht in der Fremde.“
Er begann leise den Oberkörper hin und her zu wiegen. Plötzlich wurde er sich dieser seiner Bewegung bewußt. „Weshalb wiege ich denn hin und her wie ein Elefant im Stall?“ dachte er. Dabei fiel ihm jenes Weib ein, das neulich abends liebebettelnd auf seiner Schwelle gelegen hatte. Er sah das Wiegen des flechtenschweren Kopfes, das bis zu den Hüften herab ging. Er hatte alles wohl gemerkt, trotzdem er geradeaus gesehen hatte. Einen Moment wohl durchfuhr es ihn: „Sollte nicht auch das Glück der Umarmung gesucht werden?“ Aber das waren nicht die Bilder, an welchen Suriyagodas Phantasie haftete. Noch ehe ausgedacht, war der Gedanke schon verdrängt von diesem rastlosen Suchen, diesen Qualen seiner großen Liebe.
Als er ins Kloster zurückkehrte, fand er Leute beschäftigt, Ehrenbogen aus Bambus zu errichten. Da es nicht die Zeit des Voll- oder Neumondes war, so fragte er einen dabei stehenden Mönch nach der Ursache. Der sah ihn erstaunt an. „Weißt du nicht, Bruder, daß morgen der neue Abt einzieht?“
Suriyagoda wußte von nichts. Ganz in seinen Gedanken und Zweifeln ertrunken, hatte er diese ganze Zeit wie abwesend gelebt.
Am nächsten Morgen hielt der neue Abt seinen feierlichen Einzug auf dem heiligen Fels, von den Theras in Anuradhapura geleitet.
Fast mit Schrecken sah Suriyagoda, daß es jener Mönch war, mit dem er vor so vielen Jahren von seines Vaters Hause nach Mihintale gezogen war. Die Jahre hatten ihn wenig geändert.
Als er in dieses strenge und doch milde Mönchgesicht sah, fühlte er blitzartig: „Dieser wird Hilfe bringen.“
Einzeln knieten die Mihintale-Mönche vor dem neuen Oberhaupte nieder, mit vor der Stirn gefalteten Händen dreimal den Erdboden berührend. Danach versammelte sich alles in der großen Halle, wo für jeden in zwei gegenüberlaufenden Reihen ein Kissen bereit lag.
Nach dem Range, d. h. nach dem Alter in der Mönchschaft, ließ man sich nieder, so daß die Ältesten im Orden an einem Ende, die Jüngsten am andern Ende zu sitzen kamen.
Suriyagodas Sitz fiel etwa auf die Mitte. Zerstreut und befangen saß er da. Ihm war, als ob der Abt die Augen auf ihn geheftet hielte, er wagte aber nicht hinzusehen.
Plötzlich stand ein jüngerer Mönch vor ihm, der ihm leise sagte, daß der Abt ihn zu sich wünsche. Er blickte hastig auf, da sah er jenen sich zulächeln.
Als Suriyagoda vor ihm kniete, sprach jener nicht sofort. Suriyagoda fühlte, daß er ihn prüfe und wandte das Gesicht so tief zum Boden wie möglich.
Dann begann der andere in einer milden und liebreichen Stimme, die von der Strenge seines Gesichtes merkwürdig abstach, sich nach seinem Ergehen in all diesen Jahren zu erkundigen. Es waren nur wenige leise Worte auf beiden Seiten; dann wurde Suriyagoda mit demselben liebreichen Lächeln entlassen.
Von diesem Augenblick an wurde der junge Mönch nicht mehr von dem Gedanken verlassen: „Dieser kann Hilfe bringen.“ Daneben aber wurmte stets der gleiche Zweifel: „Wenn ich ihn frage und er auch keine Hilfe weiß — was dann?“ So geschwächt war sein Willenssystem, daß er das Bewußtsein einer möglichen Hilfe dem Versuch einer wirklichen Hilfe vorzog.
An den Voll- oder Neumondtagen nahm er sich wohl vor, zu beichten, aber kam es dann so weit, so zerschellten diese Versuche stets an der Frage: „Was soll ich denn nur beichten?“ Das, mit dem er rang, diese Urneigung zu einem Göttlichen, hatte sich für ihn noch gar nicht klar genug, begriffsmäßig formuliert, um es zum Gegenstand einer Beichte zu machen. Überdies beichten mußte man Fehler. Was man beichtet, erkennt man allein durch den Akt des Beichtens als Fehler an. Und dieses Ringen mit dem Göttlichen — war denn das überhaupt ein Fehl? Sagte nicht alles rings um ihn, sagte nicht sein eigenes Dasein immer nur das Eine: „Es muß ein Schöpfer, es muß ein Erhalter da sein!“
Also so geht es mit der Lehre des Buddha, wenn man sie nur mit dem Verstande begreifen will, ohne sie an sich selber zu verwirklichen. Man gleicht dem Toren, der vor der vollen Schüssel Reis sitzt und sagt: „Nicht eher will ich hiervon essen, bis ich verstehe, wie und warum diese Nahrung sättigen kann.“
Auf einem seiner einsamen Spaziergänge, als er, wie immer in grüblerische Zweifel versunken, wieder einmal sich selber verloren hatte, kam ihm plötzlich der Entschluß, den Orden ganz zu verlassen, ins Haus seines Vaters zurückzukehren und dort in der Weise seiner Vorfahren weiter zu leben.
So mächtig überwältigte ihn dieser Gedanke, daß er beschloß, ihn auszuführen so wie er ging und stand. Ohne erst ins Kloster zurückzukehren, wollte er sich sofort auf den Weg nach Anuradhapura machen. Prüfend sah er nach der Sonne. Sie neigte sich schon merklich, aber er konnte kurz nach Sonnenuntergang in seinem Vaterhause anlangen. Seit vielen Jahren hatte er nichts mehr von dort gehört, ja er wußte nicht einmal, ob sein Vater noch am Leben war. Für den Alten selber war dieser Sohn tot. Ein Sohn, der die Götter der Väter verlassen hatte, der die Opfer verachtete, konnte sein Kind nicht mehr sein. Ganz allmählich, ohne Haß, aber auch ohne Rücksicht, hatte er den Sohn abgestoßen, wie der Baum einen welken Zweig abstößt.
Halb willenlos bog Suriyagoda in den ersten Seitenpfad ein, der von der heiligen Höhe, wo Reinheit und Keuschheit herrschte, in die Ebene hinabführte, zu den Menschen mit ihren Sorgen und ihrem Schmutz.
Er ging hier durch dichten Urwald, über dem es schon wie Abendstimmung lag. Hier und dort ließ sich das hohle Brüllen eines Affen vernehmen. Jetzt hörte Suriyagoda ein schweres Geräusch dicht über sich in den Zweigen. Es waren zwei dieser häßlichen Tiere, die miteinander kosten.
Widerwillig blickte er vor sich auf den Weg. „Überall Liebe, überall Liebe!“ Eilig schritt er weiter. Dieses Dämmerlicht des Urwaldes war ihm trotz der langjährigen Gewohnheit immer noch unheimlich.
Wieder hörte er ein schweres Geräusch, aber diesmal weit abseits im Dickicht. Er fuhr zusammen. „Ein Elefant?“ Dann sich seiner Furcht schämend, blieb er trotzig stehen. Er wollte in klarem Bewußtsein diese Gefühle der Feigheit vorübergehen lassen.
Regungslos stand er da, den Blick fest auf den Boden geheftet. Ein Zug von Ameisen lag wie ein dunkler Strick vor ihm quer über den Weg hin, die eine Hälfte des Heeres in der einen Richtung, die andere ihr entgegen strebend, und jede in einer Hast, als gelte es, die letzte Stunde dieses Lebens auszunutzen.
„Es ist die blinde Liebe für ihr Heim, das sie treibt,“ dachte Suriyagoda, während er nachdenklich auf dieses Gewimmel blickte.
Plötzlich wieder dieses schwere Geräusch im Dickicht, aber näher. Das mußte ein Elefant sein. Er fühlte, wie ihm die Knie zitterten. Solche einzeln umherschweifenden Elefanten sind nicht wie Herden-Elefanten friedlich, man möchte fast sagen kultiviert, sondern sie sind das schlimmste und bösartigste Wild, das ein Mensch treffen kann.
Er wollte davon stürzen. Aber im nächsten Augenblick kam wieder diese Scham vor sich selber. „Ich will mich nicht fürchten,“ sagte er fast störrisch. Dabei stemmte er den Fuß in den Erdboden des Fußwegs wie ein Ringer, der einen Halt gegenüber dem Gegner sucht. „Ehe ich mich fürchte, will ich wissen, warum ich mich fürchte.“
Indem sah er etwas Weißes durch das Dickicht schimmern und ein Mensch arbeitete sich, halb kriechend an den Weg heran, auf dem Suriyagoda stand.
Es war Wogiswera, der Arzt und Schulmeister unten im Dorf.
Verwirrt sah der Mönch ihn an, als er herantrat und sich tief verneigte.
Ehe er das tat, legte er vorsichtig eine Art Grabstock und ein in weiße Baumwolle gehülltes Bündelchen beiseite. Nach der Begrüßung richtete er sich schnell auf und nahm Stock und Bündelchen wieder an sich. So schritten sie schweigend den Pfad abwärts weiter, Suriyagoda zu sehr mit der Scham über sich selber beschäftigt, um den anderen zu fragen, Wogiswera zu bescheiden, um den Mönch, dem man Ehrfurcht schuldet, anzureden.
Mit einer Art Ingrimm wiederholte Suriyagoda sich immer wieder: „Wovor habe ich mich denn nun gefürchtet! Ist in allem das Göttliche und alles im Göttlichen — woher dann die Furcht? Wie stehts wohl mit meinem Glauben! Schlecht stehts! Du Narr, du Narr nach beiden Seiten hin!“
Er lachte kurz auf.
Wogiswera warf ihm einen scheuen Seitenblick zu. Er war ein Mann, fast doppelt so alt als der Mönch. Früher selber Mönch gewesen, war er vor langen Jahren, kurz ehe Suriyagoda in Mihintale in den Orden trat, in die Fesseln der Liebe gefallen, hatte geheiratet und Kinder gezeugt und erwarb sich jetzt seinen Unterhalt mit Unterrichten der Kinder des Dorfes und mit dem Heilen von Krankheiten.
Von Natur redselig, fiel ihm nichts schwerer als das Schweigen. So benützte er den Augenblick, wo Suriyagoda auflachte und sagte:
„Es ist schwer, Herr, es ist schwer.“
Der Mönch sah auf. Sein Blick blieb auf dem weißen Bündelchen Wogisweras hängen.
Unvermittelt fragte er:
„Was hast du denn da in dem Bündelchen?“
Sofort begann Wogiswera:
„Seht hier, es sind Kräuter darin; Heilkräuter für meine Frau. Sie ist krank, schwer krank und fünf Kinderchen! Es ist schwer. Ein gutes Weib, Herr! Das beste Weib der Welt. Ich will euch erzählen, wie sie krank wurde. Sie war guter Hoffnung, müßt ihr wissen. Da bekommt sie neulich Verlangen auf Zucker, weißen Zucker. Schickt den Diener hin. Weil ihr der zu lange bleibt, tritt sie selber in die Gartenpforte, um nach ihm auszusehen. Da sieht sie ihn, am Zucker naschend. Um ihn nicht zu beschämen — bedenkt, Herr, um ihn nicht zu beschämen, bückt sie sich schnell zur Erde, als ob sie da was zu schaffen hätte. Und dabei ist das Unglück gekommen. Sie war immer schwach und zart. Jetzt diese Last! Fünf Kinderchen und kein Weib im Hause, nur Unruhe und Geschrei. Ach, Herr, wenn ihr wüßtet, wie oft ich an den Klosterfrieden zurückdenke.“
„Möchtest du wieder in den Orden zurücktreten?“
„Ach, wie gern Herr! Aber kann ich! Jetzt sind es tausend Fäden, damals war es einer, ein einziger. Ich hätte ihn zerreißen können — so!“ Damit nahm er einen dürren Grashalm und zerriß ihn zwischen den Fingern. „So leicht ist es im Anfang, der Lust zu widerstehen. Je später, je schwerer.“
In diesem Augenblick drang der Ton der Klosterglocke von oben her zu ihnen, tief dunkel, dröhnend, die letzte Tagesstunde anzeigend.
Unwillkürlich blieben beide stehen und lauschten. Beide zählten die Schläge, einen nach dem andern.
Nachdem der letzte Schlag verklungen war, begann Wogiswera wieder:
„Seht, Herr, es ist im Leben gerade wie hier. Ein Schlag ist wie der andere, — einfach ein Schlag. Zählt ihr aber mit, so bekommt eben ein Schlag Sinn und Wert aus dem andern. Was ist der letzte Schlag anderes wie der erste? Ein Schlag schlechthin. Habt ihr aber vom ersten Schlag ab mitgezählt, so ist es der höchste Schlag, den es schlägt. So ist es im Leben, Herr. Es ist eines wie das andere, ein Schlag schlechthin. Zählt man aber mit, so bekommt eines aus dem anderen Sinn und Bedeutung und je länger man mitzählt, um so höher wird der Wert. Man muß sich nun fügen. Es ist zu spät jetzt. Bin ich mehr als der Buddha! Er verließ ein Söhnchen, kann ich fünf verlassen?“
„Habt ihr fünf Söhne?“ fragte Suriyagoda zerstreut.
„Das nicht Herr. Ich meine nur so. Fünf Kinderchen.“
Er schwieg und Suriyagoda verfiel wieder in sein Grübeln.
Plötzlich begann er:
„Fürchtest du dich nicht im Djungel?“
Wogiswera schüttelte den Kopf. „Nein, Herr. Ich kenne den Schlangenzauber und ich kenne den Elefantenzauber, und der Elefantenzauber ist so stark, sagen sie, daß er für die Bären mit hilft.“
„Er glaubt,“ dachte Suriyagoda. „Darum fürchtet er sich nicht.“
Indem stießen sie auf den Hauptweg, der nach rechts hin zum Kloster hinauf, nach links hin zum Dorf hinabführte.
„Hier geht euer Weg, Herr,“ meinte Wogiswera, bergauf zeigend. „Ich muß mich eilen. Es ist schon fast dunkel.“
Dabei legte er Stock und Bündelchen abermals schnell beiseite, kniete nieder und verabschiedete sich von dem Mönch. Wie urplötzlich alles eigenen Willens beraubt, wandte der sich sofort zur rechten und stieg den bekannten Weg zum Kloster hinan, während der andere halb springend bergab eilte.
Im Kloster angelangt, begab Suriyagoda sich sofort, ehe er noch seine Zelle betreten hatte, zum Abt, jetzt fest entschlossen, alles rückhaltlos zu beichten. Seinen Plan, das Kloster und den Orden ohne vorherige Ankündigung zu verlassen, mußte er doch beichten.
Der Abt saß in seinem hohen, luftigen Gemach, das durch die spärliche Beleuchtung noch größer aussah, auf einem sehr niedrigen Stühlchen, das Suriyagoda sich nicht erinnerte, je bei ihm gesehen zu haben. Es war so niedrig, daß Suriyagoda, als er vor ihm niederkniete, fast in gleicher Höhe mit ihm sich befand.
Der Abt hatte ein Palmblatt-Manuskript vor sich und schien darin zu lesen oder doch darüber nachzudenken. Das Licht stand hinter ihm, so daß sein Gesicht im Dunkeln war, während auf Suriyagodas Gesicht voll der Schein der Flamme fiel.
Es war weder Neu- noch Vollmondtag. Trotzdem, als der Mönch seine Bitte aussprach, heute beichten zu dürfen, gab jener durch Schweigen seine Zustimmung.
In innerer Hast begann Suriyagoda, weit ausholend, aber Jahre zusammendrängend. Er erzählte vom Fakir, der ihm die große Liebe prophezeit habe, vom Palmblattfächer, vom alten Abt. Dann, wie ein vulkanischer Ausbruch, stoßweise, unzusammenhängend rang sich aus ihm das Bekenntnis seiner inneren Kämpfe, dieses schreckliche Ringen zwischen Verstand und Gemüt, das ihn zu entmannen drohe. An den heutigen Fluchtversuch dachte er gar nicht mehr; er wäre auch zu erschöpft gewesen, noch von ihm zu sprechen.
Der Abt saß regungslos. Man hätte ihn für einen Schlafenden halten können, wenn das Auge nicht voll, aber mit eigenartiger Starrheit auf einen Lichtreflex gerichtet gewesen wäre, den die hinter ihm stehende Flamme auf dem Metallbeschlag des kleinen Schreines, der die heiligen Schriften enthielt, spielen ließ. Es war wie ein mildes aber starkes Sprühen, ein Licht-Wogen. Wie ein mächtiges Auge leuchtete es aus der Tiefe des dunklen Zimmers heraus.
Als der Mönch geendet, herrschte langes Schweigen. Der Abt starrte unentwegt in den glänzenden Lichtknauf vor ihm. Endlich begann er leise und eintönig:
„Ich höre dieses und du, Bruder, höre auch. Es ist, als ob die Glocke die letzte Tagesstunde verkündet. Ein Schlag, noch einer — noch einer — zwölf Schläge. Jedes ein Schlag schlechthin. Zählt man aber mit, so erhält ein Schlag aus dem andern Wert und Sinn — ja so ist es: Wert und Sinn einer aus dem andern.“
Weit aufgerissenen Auges starrte Suriyagoda den Sprecher an. Dessen Augen hingen immer noch starr am Lichtknauf. Tiefer noch als sonst lagen die harten Furchen des mageren Gesichtes. Die Lippen bewegten sich lautlos, gleichsam mechanisch den letzten Worten nachschwingend.
Plötzlich ging es wie ein Erwachen durch seine Züge. Das Auge, bisher gleichsam auf eine Unendlichkeit eingestellt, nahm Leben an. Er seufzte leicht auf und[S. 42] alles schien vorüber. Mit seiner gewöhnlichen milden Freundlichkeit blickte er auf den zu seinen Füßen knieenden Mönch. Er nahm jetzt einen höheren Sitz und es lag fast wie ein schelmisches Lächeln auf seinen Zügen, als er sagte:
„Bruder, müssen wir nicht alle durch eine große Liebe gehen? Der eine nennt sie Weib, der andere Kind; der eine Geld, der andere Ehre, und noch ein anderer nennt sie Gott. Aber alles dieses, mag es heißen wie es will, es ist ja nichts als die Liebe zum eigenen Ich. Denn: ‚Nicht um der Gattin willen ist die Gattin lieb — um des Selbstes willen ist die Gattin lieb.‘“ Und an diese Worte aus den Upanishaden anschließend fuhr er fort:
„Nicht um des Göttlichen willen ist das Göttliche lieb — um des Selbstes willen ist das Göttliche lieb. Was aber ist das Selbst? Ist, Bruder, dir wohl ganz klar geworden, was das Selbst ist? Ist, Bruder, dir wohl das Verständnis aufgegangen, daß das Ich wesenlos ist, wie die Flamme sich selbst unterhaltend durch die Nahrung, die es in jedem Augenblick heranreißt. Ist aber, Bruder, dieses Verständnis dir nicht ganz klar aufgegangen, daß das Selbst wesenlos ist; geht es dir wie jenen, die am Tage vor dem Vollmond zweifelnd fragen: ‚Ist der Mond wohl heute schon voll? Ist der Mond wohl heute noch nicht voll?‘, nun so hast du eben um solche Einsicht, um solche Erkenntnis, um solches Wissen, um solche Weisheit [S. 43]unermüdlich zu ringen. Aber es ist ja so, Bruder! Weil man sich selber nicht kennt, deswegen liebt man sich selber. Und weil man sich selber liebt, deswegen liebt man Gott. Hat man aber sich selber erkannt, hat man begriffen: ‚Von Anfangslosigkeit her brenne ich, mich selber unterhaltend, durch die Kraft meines Wollens‘ — Bruder, was soll da noch der Gott? Es ist ja alles klar geworden!“ Bei den letzten Worten machte er eine leise Bewegung mit der Hand, die aber den Eindruck machte, als umschriebe er das ganze Weltall.
Suriyagoda hatte regungslos zugehört. Nach den letzten Worten erhob er sich schweigend. Vor der Tür seiner Zelle, da wo das Weib die Blumen hingelegt hatte, nahm er Platz. Die Nacht war mondlos aber sternklar und wie leises Seufzen kam es aus dem Dunkel des nahen Waldes, wenn der Nachtwind durch die Bäume ging.
So saß er, kreuzbeinig, den Körper gerade aufgerichtet, die Hände verschlungen, das Auge fest nach innen geschlagen, die ganze Nacht. Als er zum ersten Male aufblickte, glänzten die Dagobas von Anuradhapura bereits im ersten Schein des neuen Tages. Jetzt schoß hinter ihm der Sonnenball hoch und übergoß alles ringsum mit seinem Licht.
Suriyagoda erhob sich still, schüttelte einmal kräftig sein Gewand, ordnete es frisch und begab sich zum Abt. Wieder vor ihm niederknieend bat er um die Erlaubnis, von heute ab ohne Fächer lehren zu dürfen.
Der gab still lächelnd seine Zustimmung. Er wußte: „In dieser Nacht ist dieser Bruder durch seine große Liebe hindurchgegangen, ist im Licht aufgetaucht, wird im Lichte bleiben.“
So war es mit Suriyagodas Erwachen.