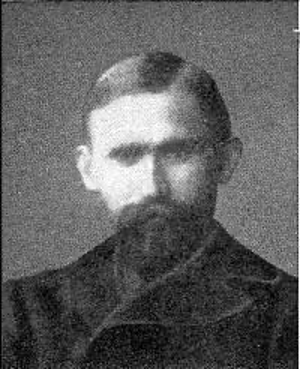In Kolombo lebte ein Mensch namens Wijasingha, der von seinem Vater ein Häuschen und 10000 Rupien geerbt hatte. Damit lebte er, ohne daß man sonderliches von ihm hörte. Der lernte eines Tages das Glück der Liebe kennen, wie die Menschen sagen. Von jeher war sein Herz der Liebe geneigt gewesen. Er liebte, geliebt zu werden. Auf alles ringsum ließ er seine Sympathien überfließen, und da all Zusammenkommen nichts ist als der Anfang der Trennung, so strichen in einem fort Wolken über seine Lebenssonne hin. Es war ein ständiger Wechsel von Licht und Schatten, von Haften und Trennen. Oft dachte er: „Wie entgeh’ ich diesem ermüdenden, schmerzhaften Spiel?“ Da kam diese große Liebe, diese wolkenlose Sonne mit strahlendem Licht, aber quälender Glut.
Der Vater seiner Geliebten war reich, geizig und stolz, und man wußte, daß schon mancher Freier von ihm abgewiesen war. Er hieß de Soysa und wohnte in der Vorstadt Kolpetti.
Als Wijasingha sich der Neigung Lucias, so hieß seine Geliebte, versichert hatte, faßte er sich ein Herz und trat mit seiner Bitte vor den Vater.
De Soysa begann bedächtig: „Freund, Du bist nicht der erste, der meiner Tochter wegen kommt, vielleicht wirst Du auch nicht der letzte sein“ — unserem Wijasingha sang der Mut gewaltig —, „indes“, fuhr de Soysa fort, „ich kannte Deinen Vater, ich kenne Dich; Ihr seid ehrbare Leute. Ich weiß auch, daß Du wohl erzogen bist. Aber wie steht es mit dem Wichtigsten?“
„O, ich denke, der Liebe Deiner Tochter bin ich gewiß.“ De Soysa lachte, daß sein Bauch etwas unruhig wurde. „Das mag für dich das Wichtigste sein, aber nicht für mich. Ich meine, wie steht es mit dem Geld? Wie viel nennst du dein eigen?“
„Du kennst mein Haus. Außerdem habe ich 10000 Rupie.“
„Nun, Freund, dann geh’ nur nach Hause. Aus dem Handel kann nichts werden.“ Als er aber Wijasinghas kummervolles und erschrecktes Gesicht sah, da kam auch in sein Herz, welches nur einer edlen Neigung, nämlich der für die edlen Metalle fähig war, etwas wie Rührung. Fast freundlich fuhr er fort:
„Siehst Du, was soll einer, der für seine Kinder sorgt, heutzutage anders machen. In früheren Zeiten galt ein Mensch so viel, als er eben war. War er wirklich was, so galt er was; war er nichts, so galt er nichts. Heute aber gilt jeder nicht das, was er ist, sondern das, was er hat. Wie sollen wir uns vor diesen Europäern anders retten, als daß wir gleichfalls beginnen, Geld aufzuhäufen? Ich weiß, es sind hier in dieser Stadt viele arme Schlucker, die im Lendenschurz und in Rindsleder-Sandalen umherlaufen, die sehen scheel auf mich, weil sie denken, es ist genug, das Wort des Buddha zu studieren und im übrigen die Welt laufen zu lassen, wie sie will. Schön! Sie sollen studieren, so viel sie wollen, aber sie sollen auch nicht heiraten. Sie schimpfen mich einen gottlosen Geldprotz. Aber glaub’ mir, Wijasingha, ich weiß, was ich tue. Du bist aber nicht gekommen, um das zu hören. Ich will milde zu Dir sein wie noch zu keinem anderen. Rühr’ Dich! Zeig, daß Du es verdienst, daß Dein Vater dir 10000 Rupie hinterlassen hat. Sie sind ihm sauer geworden, ich weiß es. Wenn Du vor mich treten und sagen kannst: 20000 Rupie sind mein eigen, so sollst Du Lucia haben, vorausgesetzt, daß sie Dich dann noch will. Bis dahin aber halte dich fern von ihr; wenn Du willst, daß ich Dir wohlgesinnt bleiben soll.“
Das war unserem Helden ein bitter-süßer Bescheid. Er hatte wohl gelernt, sich mit seinem Teil einzurichten, er wäre auch bereit gewesen, sich mit weniger zu begnügen, aber nie hatte er darüber nachgedacht, wie er wohl sein Ererbtes vermehren könnte.
Als er so in tiefsten Gedanken seinem Hause zuschritt, traf er einen bekannten Kaufmann.
„Weshalb so nachdenklich, Freund Wijasingha?“ Der sah ihn an, als ob er aus einem Traum erwache.
„Weißt Du ein Mittel, aus 10000 Rupien 20000 zu machen?“
„Weshalb nicht 100000?“ meinte der lachend.
„Mir ist gar nicht zum Spaßen. Weißt Du kein Mittel, um Geld zu verdienen?“
„Was hast Du denn mit einem Mal? Du bist doch sonst nie aufs Geld-Verdienen gewesen.“
„Laß das nur gut sein. Weißt Du mir gar nichts zu raten?“
„Ich wüßte schon etwas. Ein paar Kaufleute haben sich zusammengetan, um ein Fahrzeug auszurüsten. Wir wollen bei Manaar Perlen fischen. Das könnte seine 20 oder 30 vom Hundert abwerfen.“
Wijasingha spitzte die Ohren. „Ich will mich mit 10000 Rupien beteiligen“, sagte er entschlossen.
„Ich denke, da tust Du nicht schlecht“, meinte der Kaufmann, und der Handel wurde abgemacht.
Einige Zeit nachher kam der Kaufmann zu Wijasingha: „Freund, unsere Sache steht schlecht, wenn wir nicht noch ein paar tausend Rupien auftreiben, um uns halten zu können. Die Funde müssen kommen, siehst Du; alles liegt nur daran, Zeit zu gewinnen. Wir haben alle Weib und Kind, Du bist ledig. Überdies wird nichts geschafft, so geht mit dem unseren auch Dein Geld verloren.“
Da entschloß sich Wijasingha, verkaufte sein Haus und tat die 4000 Rupien auch noch in diesen Handel.
Als nun trotz allem die ganze Sache verloren war, war er ein Bettler.
Lucia hatte das Unglück ihres Geliebten erfahren, und er wußte, daß sie es erfahren hatte. Damit begnügte er sich. Der Mensch ist im Unglück gefaßter und verständiger als im Glück, und weil jede Spur von Hoffnung verloren war, so sagte er: „Es ist mein Karma. Ich muß mich fügen.“ Ob es freilich bei ihm Verständigkeit oder Unbeständigkeit war, ist schwer zu sagen. Sein späteres Leben spricht fast für letzteres. Immerhin: Völlig ohne Hoffnung sein, ist wahrlich nicht das schlimmste, weil es uns anregt, aus jenem Trost zu holen, das für alles Trost bietet: das Wort des Buddha, in dem alles Leid des Menschenherzens sich auflöst wie die Monsunwolken auf den Bergen, wenn sie ins warme Tal hinabgleiten. Wenn aber der Mensch vor dem zertretenen Feuer seiner Hoffnungen sitzt und das letzte Fünkchen schürt und hütet, und nichts anderes sieht und denkt, das verdirbt dieses und das nächste Leben.
So hatte Wijasingha nichts gerettet als einen gesunden Körper. Kurz entschlossen vermietete er sich als Führer eines Karrens, der zwischen Mātabe und Jaffna verkehrte. Das ist ein rauhes Leben voll äußerer Unruhe, aber gesund und beruhigend. Wenn sie abends am Brunnen lagerten oder am See, und er abseits in der stillen Nacht saß, so glitten freilich die Gedanken zurück, wie die Wasser abwärts fließen, aber nicht in Gram und Verzweiflung, sondern in Nachdenklichkeit. Wenn der Mensch aber erst einmal dahin kommt, daß er über sein Unglück denkt, so löst es sich ihm auf im Denken. Denn wer richtig denkt, der stößt auf das große Gesetz von der Vergänglichkeit, und wer auf dieses stößt, der stößt auf das große Gesetz vom Leiden, und wer dieses wittert: „Alles ist leidvoll,“ der denkt: „Was soll das Greifen! Ich greife ja nur das Leiden. Besser wahrlich ist es, ruhig in sich zu bleiben.“
So wurde ihm seine zertretene Liebe zur Staffel, auf der er in jene heiter-stillen Regionen trat, in denen sich kein Lüftchen der Leidenschaft mehr regt. Aber es war nur ein Gefühl, kein Wissen.
Als er etwa ein halbes Jahr lang zwischen Mātabe und Jaffna gefahren war, da kam ihm der Gedanke: „Wenn ich schon mein Leben lang als Karrenführer dienen muß, was fahre ich denn gerade in diesem heidnischen Lande.“ Jaffna liegt nämlich im Tamilen-Land und die Tamilen sind Shiva-Anbeter.
So wechselte er seine Stellung und verdingte sich für einen Karren, der nach Süden fuhr. Es war ihm wohler, wenn er die Dagobas und die Viharas sah.
Er mochte auch hier wohl ein halbes Jahr gefahren sein, da kam er mit seinem Karren eines Tages nach Ratnapura, der Edelstein-Stadt, in der heute noch viele Steine gefunden werden.
Hier ereignete es sich, daß einer der Buckelochsen krank wurde, und er einige Tage warten mußte. In seiner Muße setzte er sich an das Ufer des Baches und, indem er eine handvoll Sand langsam durch die Finger gleiten ließ, dachte er: „So gleiten die Augenblicke, so gleiten die Leben. Endlos ist die Reihe der Wiedergeburten, selig die Ruhe des nie mehr Auferstehens.“
Als aller Sand hindurchgeglitten war, blieb ihm ein Gegenstand in der Hand zurück, bei dessen Anblick es ihn wie ein Schlag durchzuckte. Fort waren die Gedanken vom Fluß aller Dinge und strahlend stand eines vor ihm: Glück, Liebe, Lucia! Wie Wolkenschichten ziehen die Gedanken in uns, eine Schicht über der andern, und wenn ein frischer Windstoß die unteren Wolken zerreißt, so lugen oben die Lämmerwölkchen durch, die in entgegengesetzter Richtung ziehen. Volle Ruhe ist nur, wo nicht mehr Strömung und Gegenströmung ist: die windstille, wolkenlose Ruhe des Wissens.
„Wie viel forderst Du für den Stein?“ fragte ihn der Händler.
„20000 Rupien,“ erwiderte er ohne Besinnen, „und das Reisegeld von hier bis Kolombo.“
Der sah ihn verwundert an und zahlte. Er mochte das Dreifache dafür wieder bekommen; denn es war ein Edelstein, wie er seit vielen Jahren nicht mehr gefunden war.
Daß unser Held sich auf dem Wege von Ratnapura nach Kolombo nirgends aufhielt, läßt sich heute noch nachweisen, weil er Extrapost nahm, und in den Postbüchern Tag und Stunde von Abreise und Ankunft verzeichnet stehen.
Wie er ging und stand begab er sich zu de Soysa.
„Hier sind 20000 Rupien. Gib mir jetzt Deine Tochter.“
Der ließ sich erzählen. „Du hast Glück“ sagte er dann. „Glückskind bist du,“ sagte er noch mal fast neidisch, „erstens weil Du den Edelstein gefunden hast und zweitens: Was nutzt einem Verliebten ein Diamant, groß wie ein Mangokern, wenn die Liebste nicht mehr da ist!“
„Wie meinst Du das?“
„Erschrick nicht! Ich sage ja, Du hast Glück. Sie hat mir nach Deiner Abreise so lange in den Ohren gelegen, ihr doch noch ein Jahr Freiheit zu gönnen, um, wie sie sagte, das Trauerjahr für Dich halten zu können, daß ich schließlich nachgegeben habe. Weil ich aber für Pünktlichkeit bin, so habe ich mir den Tag gemerkt. Morgen wird es just ein Jahr, daß Du weg bist, und es warten Freier. Deswegen sagte ich: Du hast Glück.“
Am nächsten Tage schon wurde Verlobung gefeiert, und unserem Wijasingha war, als ob alle Seligkeit des Himmels herunter gekommen wäre und sich just in sein Herz einquartiert hätte.
De Soysa neigte europäischen Anschauungen zu, nicht als ob er ihr Freund gewesen wäre, aber sein Lieblingsspruch war: „Man muß sie (er meinte die Europäer) mit ihren eigenen Waffen schlagen.“ Deshalb war das Leben in seinem Hause halb europäisch, deshalb hatte auch seine Tochter eine sorgfältige Ausbildung genossen und einen europäischen Namen bekommen. Er pflegte sich über solche alten poetischen Namen wie: „Freund des Jasmin“ oder „die Blüte öffnet sich“ und andere derart lustig zu machen. Dabei hielt er aber streng an der Religion des Buddha, hatte auch oben auf dem Fels vom Isevimaniya-Kloster ein Gitter gestiftet mit einer steinernen Gedenktafel. Gestiftet von M. de Soysa im Jahre — des Buddha. Ja, er ging sogar mit der Absicht um, eine neue Predigthalle in der Nähe des heiligen Bobaumes in Anuradhapura zu errichten. Seine Frau freilich war wenig mit seinen europäischen Neigungen einverstanden. Sie sah im Abweichen von den alten Sitten das Verderben und hielt sich am liebsten in der Abgeschiedenheit. Auch trug sie die steife Tracht der vornehmen Singhalesinnen, während Lucia sich europäisch kleidete auf Wunsch des Vaters. Als die Tage des ersten Rausches vorüber waren, sagte de Soysa:
„Mein Sohn, ich bin kein Freund eines langen Brautstandes. Langer Brautstand kommt mir vor, als wenn jemand sich den Strick um den Hals schnürt, bevor er sich wirklich hängen will.“ Er lachte, daß draußen ein paar Vögel erschreckt aufflogen und überließ es Wijasingha, sein Gesicht zu stellen, wie es ihm gutdünkte.
„Nun, nun,“ fuhr er fort, „man macht so seine Scherze. Der Tag sieht am Abend anders aus wie am Morgen. Also auf den Tag einen Monat soll Euer Brautstand dauern. Dann gibt es Hochzeit.“
Unserem Wijasingha war, als ob man ihm nach der Aloe Honig in den Mund steckte.
„Nun aber rühr’ Dich,“ fuhr de Soysa fort, „daß Du Deine Frau in ein Heim führen kannst, wie es sich für Dich und mich gehört.“
„Ich dachte, in der Umgegend der Stadt ein kleines Häuschen zu erwerben und da einfach und zufrieden zu leben.“
„Laß den Gedanken fahren. Mein Schwiegersohn kann nicht wie ein Bauer oder Krämer wohnen, in einer Lehmhütte.“
„Nicht Lehmhütte —.“
„Schon gut! sag’ ich. An der Seeseite, dicht hinter Kolupitiya-Station ist ein Haus frei.“
„Das, was der deutsche Kaufmann bewohnt hat?“
„Eben das.“
„Die Miete ist hoch.“
„Drum rühr’ Dich, rühr’ Dich! Der Mensch muß einen Sporn haben, wenn er vorwärts kommen will. Widerstand braucht der Mensch zum Gedeihen, nichts als Widerstand.“ Dabei machte er eine Bewegung mit den Armen wie ein Athlet, der im Begriff ist, sich auf den Gegner zu stürzen.
So mietete Wijasingha das Haus an der Seeseite und begann es auszustatten. Welche Arbeit! Wie viel Laufen, wie viel Reden, wie viel Ärger! Hätte ihm nicht der Abend mit der Liebsten gewinkt, er hätte längst gesagt: Ich mag nicht mehr!
Über die Hälfte des Monats war verflossen, da kam eines Morgens sein Schwiegervater eilig zu ihm.
„Sohn,“ sagte er fast feierlich, — denn je reicher einer wird, um so mehr Ehrfurcht hat er vor dem Geld — „ich sorge für meine Tochter, wenn ich für Dich sorge. Kennst Du Galgulum?“
„Freilich! Es liegt nördlich von Matale,“ erwiderte der ganz erstaunt.
„O, Du kennst es aus Deiner Fuhrmannszeit,“ rief der Alte lustig. „Danke den Göttern, daß Du einen Schwiegervater hast, der auf solche Sachen nichts gibt. Bei mir heißt es nicht: Zeige, was Du gewesen bist! sondern: Zeige, was Du bist! Laß sie in Kolombo nur kichern. Wenn Du was geschafft hast, werden sie aufhören. Wer Geld hat, der hat alles. Und Du wirst was schaffen. Du bist ein Glückskind. Wie hättest Du sonst den Stein gefunden. Denkst Du, wegen der 20000 Rupien allein, habe ich Dir meine Tochter gegeben! Aber genug der Schwätzerei! Also hör’ zu! Um den See von Galgulum wird Land urbar gemacht. Es ist alles im Stillen betrieben. Ich habe es eben erst erfahren. Verstehst Du nicht? Die Regierung will nicht, daß Geschäfte damit gemacht werden, indem einer das Ganze kauft, sondern will stückweise an die Bauern verkaufen. Unser Bauer hat aber kein Geld. Es ist ein wundervolles Geschäft, wenn wir zuerst hinkommen.“
Wijasingha verstand immer noch nicht.
„Verstehst Du noch nicht? Wir gehen hin, d. h. ich überlaß Dir das ganze Geschäft. Ich will Dich anlernen im Geldmachen, ich will Dir Mut und Lust zum Geschäft machen. Wir leihen den Bauern, damit sie kaufen können und nehmen unsere Zinsen. Ich habe meine Leute dort.“
„O, so meinst Du,“ sagte Wijasingha gedehnt.
„Bist Du bereit?“
„Wozu?“
„Abzureisen!“ rief der Alte heftig werdend. „In einer Stunde geht der Zug nach Kandy.“
„Wie lange bleiben wir denn?“
„Etwa drei Tage.“
„So muß ich doch erst von Lucia Abschied nehmen.“
„Du bist toll! Wir verlieren einen ganzen Tag. Das Geld läuft Dir fort, nicht die Braut.“
Verdrießlich saß Wijasingha im Coupé neben seinem schnarchenden Schwiegervater. Der Zug lief durch diese endlosen Reisfelder, die von Areka- und Kokos-Palmenwäldchen unterbrochen waren. Es war anmutig, aber eintönig. Er griff aus langer Weile die Zeitung, die dem Schlafenden aus den Händen gefallen war. Für ihn stand nichts darin.
Jetzt begann die Steigung der Bahn. Die Luft wurde frischer, leichter, die Bilder ringsum immer kühner, gewaltiger. Aus Ausschnitten lugten wilde Felsmassen gleich Türmen und Burgen; tief, tief unten im Tal lachte das helle Grün der Reisfelder, deren regelmäßige Furchen wie gemalt aussahen. Und wenn der Ausblick sich rückwärts in die Ebene eröffnete, so glitt das Auge wie in die Unendlichkeit.
Sein Entzücken stieg. Er war fast versucht, den Schlafenden zu wecken. Ihm war es solch eine Freude, wenn jemand neben ihm stand und ihm sagte: „Wie wunderschön!“
Sie waren jetzt fast auf der Kammhöhe. Der Alte gab einen Ton von sich, als wenn er im Erwachen wäre. Wijasingha hielt es nicht länger aus.
„Sieh nur, Vater!“ rief er.
Der Alte rieb sich die Augen. „Was ist los?“
„Sieh nur die Aussicht.“
De Soysa spuckte gleichgültig aus. „Steine genug,“ meinte er. „Unsere Aussichten sind in Galgulum.“ Damit drehte er sich nach der anderen Seite und schnarchte weiter.
Sie übernachteten in Mātale, dem Endpunkt der Bahn. Am nächsten Morgen fuhren sie mit der Post nach Galgulum weiter, von zwei Leuten begleitet, welche de Soysa mit tiefster Ehrfurcht behandelten.
An Ort und Stelle machte sich der Alte sofort mit den beiden ans Werk. Es schien ihm nicht daran gelegen zu sein, den Schwiegersohn jetzt bei sich zu haben.
„Nimm die Gegend in Augenschein, derweil ich mit den Leuten rede,“ sagte er.
Das war dem schon recht. Er schlenderte gemütlich um den weiten See. Große Strecken waren entsumpft worden und harrten wieder ihrer Bestimmung. Dieses wüste Gebiet, welches heute die ganze Nordhälfte der Insel einnimmt, war früher unter den buddhistischen Königen die Kornkammer Ceylons und von Millionen bevölkert.
Die Abendmahlzeit nahmen beide gemeinschaftlich im Rasthaus ein. De Soysa war in bester Laune. Er berichtete über die Abmachungen, die er getroffen hatte. „Lies nur!“ Damit breitete er seine Papiere vor Wijasingha aus.
Der begann den Inhalt zu studieren, erst nur so obenhin, allmählich aber wurde er aufmerksam. „Vater,“ sagte er endlich, „wovon sollen denn aber die armen Leute leben? Sie müssen Dir ja alles geben.“
Der sah ihn eine Weile sprachlos an, dann sagte er: „Hab’ ich denn die Leute gezwungen, solche Abmachungen zu treffen? Hab’ ich ein Recht, eine Gewalt, sie zu zwingen? Wenn ich mein Geld arbeiten lasse, so gut ich kann und für meine Familie sorge. — Aber was sag’ ich! Ich sorge ja garnicht für mich. Ich lasse ja Dein Geld arbeiten. Zum ersten Mal in meinem Leben lasse ich mir einen Profit entgehen und gleich habe ich meinen Lohn. Es geschieht mir schon recht, mir altem Narren. Das kommt davon, wenn man mehr für andere sorgt, als für sich selbst.“
Je mehr er redete, um so heftiger wurde seine Stimme. „Überhaupt sage ich Dir, es ist ein Unterschied, ob man als Einzelner durch die Welt geht, oder ob man eine Familie hinter sich hat. So lange Du einzeln bist, magst Du tun und lassen, was Du willst, ja Du magst, wenn es Dir so beliebt, Dich in einen Winkel setzen und freiwillig verhungern. Hast Du aber Weib und Kind, so sind die Zeiten vorbei. Da heißt es: Rühr’ Dich von früh bis spät! Willst Du denn, wenn Du mal stirbst, daß Dein Weib trägt und Deine Kinder Karren ziehen! In der Ehe pfeift ein scharfer Wind, Freund. Ich weiß, Du hast allerhand Flausen im Kopf. Die Worte des Buddha sind nicht dazu da, daß man mit ihnen durch dick und dünn geht. Wer das will, der darf sich nicht verlieben. Hörst Du, nicht verlieben! Laß das, Sohn, ich meine die Kopfhängerei!“ fuhr er milder fort. „Ich warne Dich ernsthaft.“ Damit packte er die Papiere zusammen und verließ den Raum.
Wijasingha stand ein Weilchen regungslos, dann verließ auch er den Raum und das Haus. Ihm war zumut wie einem Menschen, der morgens erwacht mit dem Gefühl: Es ist etwas nicht in Ordnung mit Dir.
Wieder kam er zum See. Über den hohen Steindamm ging ein starker, warmer Wind. Die Sonne hing tief, rings von glühenden Wolkenfetzen umgeben. Fern auf dem Wasser lagen wunderbare Farben. Sie sahen aus wie farblose Schatten, blickte man aber still hin, so entdeckte man das schnelle Spiel von Gold und Violett. Er ließ sich unten am Steindamm nieder. Er entledigte sich der Schuhe und tauchte die Füße leise ins Wasser. Kosend kamen die Wellen. Er saß still und schaute und schaute. Vergessen war alles. Ihm war wie einem, der seine letzte Arbeit getan und nun ruhevoll vor seiner Hütte sitzt und dem Klang der Abendglocken lauscht. O, du kühler seliger Abendfriede!
Ein einsamer Kranich durchfurchte stolz mit gebogenem Hals das Wasser, eine lange Furche nach sich ziehend. Jene Stelle aus den Suttas kam ihm in den Sinn: „Zweierlei Freuden, ihr Jünger, gibt es. Welche zwei? — Die Freude des Familienlebens und die Freude des heimatlosen Lebens.“
Jetzt hörte er Laute über sich. Oben auf dem Damm ging ein junger Mensch mit einem Mädchen. Beide taten zärtlich zueinander und sahen ihn nicht. Der junge Mensch sang dem Mädchen eine Melodie vor, die diese versuchte nachzusingen, aber immer falsch. Er wiederholte unverdrossen, nur unterbrochen durch die Liebkosungen des Mädchens.
Die Szene erschien unserm Wijasingha albern. Das Mädchen war nicht mehr jung, offenbar älter als der Jüngling und begann schon korpulent zu werden. „Nichts ist alberner als das Verliebtsein“ dachte er.
Plötzlich hörte er de Soysas Worte wieder: „In der Ehe pfeift ein scharfer Wind.“ Wieder hatte er dieses unangenehme Gefühl eines, der erwacht und weiß: Es ist etwas mit mir. „Wann war ich wohl besser dran, jetzt wo ich als Schwiegersohn des reichen de Soysa hier sitze oder damals, als ich als Karrenführer hier übernachtete und abseits am Lagerfeuer saß, alle Sterne des Himmels über mir, das Glück des Freiseins von Wünschen genießend. Damals war mir das Leben ein Ding zum Schauen, ein Ding, von dem der Verständige weiß: Es ist ein Spiel. Jetzt soll ich aufhören, Schauer zu sein. Jetzt soll ich selber handeln, mich abmühen, mich drängen und stoßen lassen und für alle Püffe danken als für ein Lehrgeld.“ Er zog die Mundwinkel nach unten und bog den Kopf ein wenig zurück wie ein Kind, das eine widrige Nahrung abweist.
„Weshalb aber das alles?“ Er meinte des Alten Worte zu hören: „Wer das nicht will, der darf sich nicht verlieben.“ Mißmutig stieß er einen Kiesel ins Wasser. Der zog seine Ringe, einen nach dem anderen, immer weiter. Wijasingha blickte aufmerksam. „So folgt jeder Ursache die Wirkung; so hat jede Tat ihre Folge, unausweichlich. Unterlaß die Tat, so werden die Folgen ausbleiben. Andere Hilfe ist nicht. Meine Tat ist die Liebe zu Lucia, ihre Folgen sind das Hasten und Mühen des Familienlebens. Und nur des Familienlebens? Bin ich seit diesem Glückstag schon einen Augenblick ganz ruhig, ganz glücklich gewesen? Muß ich nicht auf jedes ihrer Worte, auf jeden ihrer Blicke achten! Ich will, daß sie da redet, wo ich meine, daß geredet werden soll; daß sie da schweigt, wo ich meine, daß geschwiegen werden soll. Rastlos läuft mein Herz mit ihr wie ein Hündchen mit seinem Herrn. Eine mühevolle Arbeit!“ Er schwieg gedankenvoll.
Die Sonne war verschwunden. Auf dem Wasser lag das eintönige Grau des Abends.
Sie blieben noch einen Tag hier. Dann kehrten sie nach Kolombo zurück, der Alte aufgeräumt, der Junge zerstreut und nachdenklich. Es war nicht de Soysas Sache, durch anderer Stimmungen mit berührt zu werden. War er guter Laune, so galt ihm als selbstverständlich, daß der andere es auch war.
Wijasinghas erster Gang galt seiner Braut.
Er traf sie mit einem jungen Menschen im Gespräch, den Wijasingha nicht leiden mochte. Es war ein eitler Bursche, von dem man wohl wußte, daß er gleichfalls Absichten auf die schöne Lucia gehabt hatte, beiläufig ein entfernter Verwandter und Namensvetter der Familie.
Als Wijasingha eintrat, lachten beide gerade lustig, verstummten aber sofort.
Lucia sprang auf, um ihren Bräutigam zu umarmen; der aber meinte grämlich:
„Wovon spracht Ihr denn gerade, als ich Euch unterbrach?“
„Aber,“ sagte Lucia, „wir sprachen von den Pferderennen.“
„Deswegen brauchtet Ihr doch nicht so plötzlich verstummen.“
„Aber — sollte ich Dich denn nicht begrüßen?“
Sie lachte lustig und der junge de Soysa mit.
Wijasingha wollte auffahren. Plötzlich blieb sein Auge auf dem lachenden Gesicht seiner Braut hängen. Er hatte sie in dieser etwas spöttischen Weise noch nie lachen sehen und halb mit Staunen, halb mit Schrecken sah er auf diesem blühenden hübschen Gesicht, der durch einen haarfeinen Flaum etwas sammetartiges bekam, etwas weich nachgiebiges, das ihn stets so entzückt hatte, die Züge des Vaters, des alten de Soysa hervortreten.
Lucia war ein gutes Mädchen, wie sie durch ihr entschlossenes Warten auf ihren Geliebten bewiesen hatte, aber tatsächlich vom Charakter ihres Vaters, weder gewohnt noch befähigt, in anderen zu lesen.
Als sie daher das kühle, zerstreute Wesen ihres Bräutigams sah, wendete sie sich ganz dem jungen de Soysa zu und Wijasingha saß schweigend daneben, während die beiden miteinander scherzten.
Plötzlich war ihm, als ob alle Verdrossenheit, alle innere Gereiztheit, aller Widerwille gegen de Soysa, aber auch alle Liebe gegen Lucia dahinschwänden und nichts bliebe, als eine unwiederstehliche Neigung nachzudenken.
Sein Auge lag sinnend auf den feinen Linien seiner Braut, aber weil die Sinnlichkeit ihn verlassen hatte, so suchte er im Nachdenken dieses Wesen da vor ihm gleichsam zu analysieren, in seine Bestandteile aufzulösen. Es wurde ihm klar und klarer: „Das, was mich bisher in einem Taumel gehalten hat, das wird in längerer oder kürzerer Zeit dahin sein. Lohnt es sich, deswegen seine Ruhe und Unabhängigkeit hinzugeben? Sind sie nicht auch Güter, ebenso süß wie die Sinnenlust? — Wenn ich das aber alles lasse, wofür lebe ich dann noch? — Und plötzlich: Wofür lebe ich überhaupt? Wofür leben die Menschen? Wozu ist dieses alles?“
Ein plötzliches Staunen ergriff ihn, daß überhaupt etwas da sei und für einen Augenblick durchzuckte ihn die Einsicht, gleichsam fühlbar, wie jemand seine eigenen Glieder fühlt: Ist etwas da, kann es nie nicht dagewesen sein; muß von Anfangslosigkeit her da sein. Ist es so, nun so muß man eben dem Heiligen, dem vollkommen Erwachten folgen. Dann gibt es ja kein anderes Ziel als das Aufhören, das Eingehen, das Verlöschen.
Indem trat der alte de Soysa ein und erfüllte mit seiner dröhnenden Lustigkeit den ganzen Raum.
Wijasingha verabschiedete sich so bald es anging und noch am selben Abend schrieb er an seine Braut sowohl wie an deren Vater, daß er entschlossen sei, alle weltlichen Pläne fallen zu lassen und Mönch zu werden.
Am nächsten Morgen in aller Frühe fuhr er nach Ratmalana hinaus, um dort im „Kloster zum allervorzüglichsten Gesetz“ um Aufnahme zu bitten.
Während er aber in der weiten Vorhalle auf das Erscheinen des Abtes wartend auf und ab ging, hörte er nicht das ruhevolle Rauschen der Palmwedel, das nur eine Melodie singt: „Laß fahren, es ist nicht der Mühe wert!“, sondern er hörte vor seinem geistigen Ohre die Stimme seiner Braut, er meinte sie vor sich zu sehen in ihrer wollusterregenden Schönheit, die ganz Colombos Jugend in Bann hielt. „Auf dich hat sie ein ganzes Jahr gewartet, während alles ihr zuflog. Wonach andere sich hoffnungslos sehnen, das wirfst du Narr leicht von dir.“
So sprang er, von seinen Empfindungen überwältigt, kurz entschlossen in das draußen wartende Ochsenwägelchen, ohne den Abt abzuwarten, und fuhr schnurstracks nach Colombo zurück, um womöglich gut zu machen, was noch gut zu machen war.
Trotz seiner Angst vor dem Alten trat er entschlossen in die Vorhalle und ließ sich vom Diener melden. Der aber kam sogleich mit der Botschaft zurück, daß niemand zu sprechen wäre.
Da sah Wijasingha, daß alles verloren war und kehrte voller Verzweiflung in seine Wohnung zurück. Was er vor einem Jahr mit Fassung und Vernunft getragen hatte, das machte ihn jetzt fassungslos und halb wahnwitzig.
Als er bei sich angekommen die leeren Räume betrat, überkam ihn solch ein Ekel vor der Zwecklosigkeit des Lebens, daß ihm war, als ob es ihn anröche. Und was er gestern aus wahrer Einsicht in die Natur des Lebens tun wollte, das entschloß er sich nun, aus Ekel am Leben zu tun: Alles aufzugeben und ins Kloster zu gehen.
Nach dem „Kloster zum allervorzüglichsten Gesetz “ zurückzukehren, schämte er sich. So beschloß er, nach Kelanya zu gehen, wo ein Verwandter von ihm schon seit Jahren als Mönch lebte.
Der Abt, der ihn kannte, nahm ihn gütig auf.
Als Wijasingha nun, nachdem er die Erlaubnis zum Eintritt erhalten hatte, meinte, er wolle zurückfahren, um zu Hause erst alles zu ordnen, erwiderte der Abt lächelnd, ob er nach seinem Tode denn auch nachsehen wolle, ob beim Leichenschmaus alles gut geordnet sei?
Daraufhin blieb Wijasingha dort, so wie er war, übersandte nur seinem Hausverwalter einige Anordnungen.
Nun hatte er freilich zu seinem eigenen Erstaunen die Liebe zu Lucia bald ganz überwunden, wie sich klar darin zeigte, daß er ihre bald darauf erfolgende Verheiratung mit dem jungen de Soysa ohne Kummer vernahm. Sein eigener Spruch war stets gewesen: „Der Mann ist nicht wert, Mann zu heißen, der an einer Weiberliebe zu Grunde geht.“ Trotzdem kam er nicht aus dem inneren Schwanken heraus. Er blieb in einem Zustand fruchtloser Nachdenklichkeit. Die Wahrheit der Buddhalehre leuchtete ihm ein, aber nicht die Notwendigkeit, die Welt zu lassen. So glich er einem Ochsen, der zwischen zwei Bündeln Gras langsam verhungert, weil er nicht weiß, bei welchem er anbeißen soll.
Etwa zwei Jahre quälte er sich in dieser Weise hin. Als er nun einmal durch einen halb-blödsinnigen Menschen, der die ganze Nacht vor der Tür des Viharas gesungen und gebetet hatte, am Schlaf behindert worden war, so war ihm das, weil eben gar kein innerer Halt in ihm war, Anlaß genug, das Kloster und den Mönchstand zu verlassen.
Draußen ergab er sich aber bald einem lockeren Lebenswandel, bei dem all sein Hab und Gut verloren ging.
Danach verdingte er sich wieder als Karrenführer; lebte aber nicht wie damals in heiterer Ruhe, sondern elend, weil er seinen ganzen Verdienst meist in Palmschnaps vertat. Er war eben auf abwärtsführende Fährte geraten, wie es wohl geschehen kann, so lange jemand im Begreifen nicht festen Halt gefunden hat.
Und dabei geschah es, daß er nicht nur sich quälte, sondern auch andere, indem er seine Ochsen schlecht behandelte, so daß alle redlich Denkenden sich von ihm abwandten.
Als er einstmals einen Ochsen so geschlagen hatte, daß ihm Blut von den Weichen tropfte, warnten ihn die anderen und sagten: „Denk’ an Deine nächste Geburt.“ Aber Wijasingha, der schon ganz verkommen war, antwortete roh: „Kümmert Ihr euch nur um euch selber.“
Da erschraken die anderen Karrentreiber und sagten unter sich: „Was können wir tun? Es kommt auf sein Karma.“
Eines Tages hatte er in der Nähe von Pallai einem Weibe am Wege einige große Mangos abgekauft und wollte gerade die nötigen Kupfer aus dem Gürtel ziehen, um zu bezahlen, als ein Weißer des Weges kam, der gleichfalls bei dem Weibe stehen blieb, um Mangos zu kaufen.
Da nahm das Weib Wijasingha die Mangos wieder ab und gab sie dem Weißen, weil er mehr zahlte. Wijasingha aber wurde darüber aufs höchste aufgebracht und da er weder am Weibe noch an dem Weißen seine Wut auslassen konnte, so ließ er sie an sich selber aus, indem er all sein Geld in der nächsten Taverne vertrank.
Als es nun zum Abend ging, wo die Karrenführer ihren Reis nehmen, hatte er kein Geld, um sich eine junge Kokosnuß für den Kurry zu kaufen. Daher stieg er, als es dunkel geworden war, auf einen Palmbaum, um eine zu stehlen.
Sei es nun, daß die Eile, oder die Dunkelheit oder der reichliche Branntwein schuld waren — oben, dicht unter der Krone, stürzte er ab und brach das Genick. In Ceylon sagt man aber, daß, wer beim Besteigen eines Palmbaumes verunglücke, ein schlechter Mensch sein müsse. Wie weit das freilich für Wijasingha zutrifft, will nicht ich entscheiden.
Der Abt von Kelanya aber pflegte ihn als Beispiel anzuführen, wenn er über das Wort des Buddha predigt, daß die Lehre, falsch befolgt, wie ein Messer sei, daß man bei der Schneide fasse. Es nütze nichts, sondern verletze nur die Hand und gäbe nichts als Schmerz und Schaden.